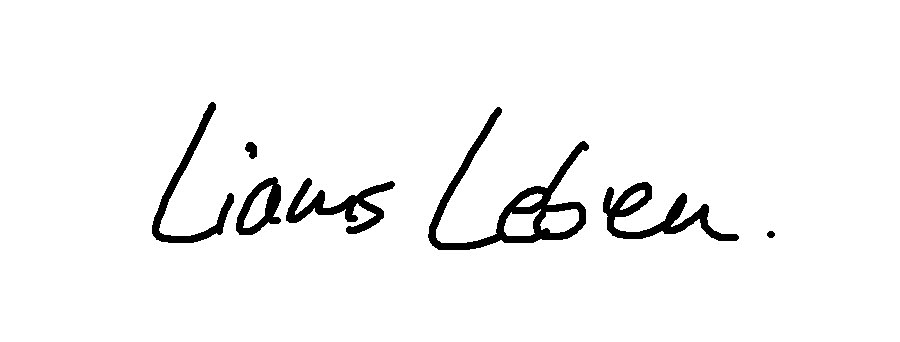Ich träume davon, glücklich zu sein. Zu lachen, strahlend durch die Welt zu laufen, jeden Tag die Marmeladengläser mit Glücksmomenten zu füllen. In jeder Blume die Schönheit der Welt zu erkennen. Auch zu lachen, wenn ich in Scheiße trete. Mich auch über Fehler zu freuen.
Ich träume davon, die Welt zu retten. Und alle Menschen gleich mit. Die Kinder, die Hunger leiden und an Krankheiten sterben, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Die Frauen und Männer und alle, die zu Tode gefoltert werden, die Ungerechtigkeit erleben. Tag für Tag. Und all diejenigen, in deren Leben nur Schmerz ist oder nur Leere oder nur Taubheit.
Ich träume davon, abends die Augen zu schließen und in einen ruhigen Schlaf zu fallen - morgens die Augen zu öffnen, mit einem Lächeln auf dem Gesicht.
Doch wenn ich mich ins Bett lege und versuche, zur Ruhe zu kommen, wenn ich die Lichter ausschalte und mich auf die Suche nach meinen Träumen begebe, dann finden sie nicht den Weg zu mir; nur schwarze Bilder, nur Horrorszenarien, nur Albträume laufen vor meinem inneren Auge ab.
Dabei träume ich doch so viel Schöneres.
Montag, 16. Dezember 2013
Dienstag, 10. Dezember 2013
Schöne Melancholie.
Ich zelebriere die Traurigkeit. Lebe in Melancholie. Und will es so. Irgendwie.
Ich genieße die Einsamkeit, erfreue mich an Depression. Ab und an.
Weil aus ihr so was wie Glück entsteht. So was wie Erleuchtung. Wie Inspiration.
Weil es vielleicht meine Bestimmung ist, melancholisch zu sein.
Ich bin glücklich darüber, traurig zu sein. Vielleicht muss man einfach akzeptieren, dass das geht. Dass Trauer schön sein kann. Dass Depression bereichern kann. Dass Glück nicht immer Jubel ist.
Vielleicht. Ist Leben nicht nur schwarz und weiß.
Ich genieße die Einsamkeit, erfreue mich an Depression. Ab und an.
Weil aus ihr so was wie Glück entsteht. So was wie Erleuchtung. Wie Inspiration.
Weil es vielleicht meine Bestimmung ist, melancholisch zu sein.
Ich bin glücklich darüber, traurig zu sein. Vielleicht muss man einfach akzeptieren, dass das geht. Dass Trauer schön sein kann. Dass Depression bereichern kann. Dass Glück nicht immer Jubel ist.
Vielleicht. Ist Leben nicht nur schwarz und weiß.
Samstag, 7. Dezember 2013
Weihnachts-scheiß-spaziergang.
Ich laufe durch die dunkle Stadt, die gar nicht dunkel ist. Weihnachtssterne leuchten mich an, Lichterketten glänzen vor dem schwarzen Himmel, Weihnachtsmänner strahlen um die Wette.
Der Schnee reflektiert die Lichter der Stadt.
Ich friere, aber es ist gar nicht kalt. Und eigentlich friere ich auch nicht. Bloß meine Hände sind kalt, vielleicht hätte ich doch Handschuhe anziehen sollen. Vielleicht auch nicht, denn eigentlich ist es ja ganz angenehm, wie die Kälte so durch meine Haut kriecht.
Ich halte an, blicke mich um. Keiner da, gut. Keiner sieht mich, gut. Ich beuge mich nach unten, stecke meine Hände in den Schnee. Es ist so kalt, es ist so nass, ich fühle mich. Ich fühle die Welt um mich herum.
Aber sie fühlt mich nicht, sie sieht mich nicht, merkt mich nicht. Mit meinen tauben Fingern forme ich einen Schneeball und schleudere ihn gegen ein Straßenschild. Ich will, dass es ihm wehtut. So wehtut, wie mir. Und ich will schreien, so laut ich kann. Aber ich schreie nicht. Ich blicke mich um, ich schließe die Augen, ich bleibe noch ein paar Minuten stehen und lausche der Stille. Der Stille, die mich umgibt. In die ich mich anpasse. In der ich verschluckt werde.
Meine Hände beginnen zu schmerzen, während mein Blut sie wieder erwärmt. Ich stecke sie in meine Taschen und mache mich wieder auf den Weg. Schritt für Schritt, ich trete in jede Schneewehe, die ich finden kann. Meine Stoffschuhe durchweichen. Gut so. Ich habe sie extra angezogen, ich habe auch keine Winterschuhe, es ist mir auch egal. Sollen sie doch nass werden. Sollen meine Füße doch erfrieren. Sollen sie doch einfach stehen bleiben. Dann friere ich halt hier fest. Mitten auf der Straße.
Ich bleibe wieder stehen und stelle mir vor, wie das wäre. Festgefroren zu sein. Verbunden mit dem Boden, auf alle Zeit. Schaulustige würden ankommen und mich betrachten. Die stärksten Männer der Welt würden kommen und versuchen, mich zu befreien. Autos würden hupen. Vielleicht würden sie mich plattfahren, überfahren, totfahren. Warum eigentlich nicht.
Aber ich hebe meine Beine wieder an, ich setze sie wieder auf, ich gehe rechts, links, rechts, links. Ich werde immer schneller, beginne zu laufen. Durch die taghelle Nacht.
Ich höre Kinder lachen aus einem Haus und ich verlangsame meine Schritte. Ich rieche etwas; etwas, was ich kenne. Was ist das nur, das sind ja Waffeln, frisch gebacken, frisch duftend, gleich werden sie mit Puderzucker bestreut. Ich überlege kurz, ob ich klingeln soll, um zu fragen, ob ich nicht vielleicht mitessen darf oder zumindest zugucken, nichts sagen, nur riechen und gucken und hören und alles in mich aufnehmen. Stiller Beobachter der Vorweihnachtszeit.
Nein danke, ich lass es lieber sein. Und renne weiter, schnell, ehe ich es mir noch anders überlege und mich zum Affen mache, nein danke, nein danke, danke nein.
Ich versuche meine Ohren für den letzten Kilometer zu verschließen. Ich will nicht die Lieder hören, die aus den Häusern dringen, ich will nicht die Kinder hören, die im Garten Schlitten fahren, ich will nicht die lachenden Menschen hören, die gemeinsam um das Lagerfeuer herumstehen. Oder doch, ich will mich dazustellen, ich will mich wärmen, ich will ... weiterrennen.
Und ich stecke den Schlüssel ins Türschloss, meine Finger zittern, sie sind taub. Ich drehe und drehe und hoffe, dass mich keiner meiner Nachbarn beobachtet.
Als ich Tür schließlich öffne, begrüßen mich Dunkelheit und der Fernseher. Ups, hab ich doch glatt vergessen, ihn auszuschalten. Ist auch egal, ist eh alles egal.
Ich drehe den Wasserhahn auf und halte meine roten Finger unter den heißen Strahl. Das Brennen kriecht durch meinen ganzen Körper. Und aus dem Wohnzimmer der Torschrei eines Sky-Moderators, meilenweit entfernt von mir. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich nicht alleine lässt. Trotzdem nervst du mich, du hast ja keine Ahnung, ich schalte dich ab.
Und auf einmal ist es still. Und dunkel. Nein, doch nicht. Der helle Weihnachtsstern der Nachbarn leuchtet durch das Fenster.
Hallo Weihnachtswelt.
Der Schnee reflektiert die Lichter der Stadt.
Ich friere, aber es ist gar nicht kalt. Und eigentlich friere ich auch nicht. Bloß meine Hände sind kalt, vielleicht hätte ich doch Handschuhe anziehen sollen. Vielleicht auch nicht, denn eigentlich ist es ja ganz angenehm, wie die Kälte so durch meine Haut kriecht.
Ich halte an, blicke mich um. Keiner da, gut. Keiner sieht mich, gut. Ich beuge mich nach unten, stecke meine Hände in den Schnee. Es ist so kalt, es ist so nass, ich fühle mich. Ich fühle die Welt um mich herum.
Aber sie fühlt mich nicht, sie sieht mich nicht, merkt mich nicht. Mit meinen tauben Fingern forme ich einen Schneeball und schleudere ihn gegen ein Straßenschild. Ich will, dass es ihm wehtut. So wehtut, wie mir. Und ich will schreien, so laut ich kann. Aber ich schreie nicht. Ich blicke mich um, ich schließe die Augen, ich bleibe noch ein paar Minuten stehen und lausche der Stille. Der Stille, die mich umgibt. In die ich mich anpasse. In der ich verschluckt werde.
Meine Hände beginnen zu schmerzen, während mein Blut sie wieder erwärmt. Ich stecke sie in meine Taschen und mache mich wieder auf den Weg. Schritt für Schritt, ich trete in jede Schneewehe, die ich finden kann. Meine Stoffschuhe durchweichen. Gut so. Ich habe sie extra angezogen, ich habe auch keine Winterschuhe, es ist mir auch egal. Sollen sie doch nass werden. Sollen meine Füße doch erfrieren. Sollen sie doch einfach stehen bleiben. Dann friere ich halt hier fest. Mitten auf der Straße.
Ich bleibe wieder stehen und stelle mir vor, wie das wäre. Festgefroren zu sein. Verbunden mit dem Boden, auf alle Zeit. Schaulustige würden ankommen und mich betrachten. Die stärksten Männer der Welt würden kommen und versuchen, mich zu befreien. Autos würden hupen. Vielleicht würden sie mich plattfahren, überfahren, totfahren. Warum eigentlich nicht.
Aber ich hebe meine Beine wieder an, ich setze sie wieder auf, ich gehe rechts, links, rechts, links. Ich werde immer schneller, beginne zu laufen. Durch die taghelle Nacht.
Ich höre Kinder lachen aus einem Haus und ich verlangsame meine Schritte. Ich rieche etwas; etwas, was ich kenne. Was ist das nur, das sind ja Waffeln, frisch gebacken, frisch duftend, gleich werden sie mit Puderzucker bestreut. Ich überlege kurz, ob ich klingeln soll, um zu fragen, ob ich nicht vielleicht mitessen darf oder zumindest zugucken, nichts sagen, nur riechen und gucken und hören und alles in mich aufnehmen. Stiller Beobachter der Vorweihnachtszeit.
Nein danke, ich lass es lieber sein. Und renne weiter, schnell, ehe ich es mir noch anders überlege und mich zum Affen mache, nein danke, nein danke, danke nein.
Ich versuche meine Ohren für den letzten Kilometer zu verschließen. Ich will nicht die Lieder hören, die aus den Häusern dringen, ich will nicht die Kinder hören, die im Garten Schlitten fahren, ich will nicht die lachenden Menschen hören, die gemeinsam um das Lagerfeuer herumstehen. Oder doch, ich will mich dazustellen, ich will mich wärmen, ich will ... weiterrennen.
Und ich stecke den Schlüssel ins Türschloss, meine Finger zittern, sie sind taub. Ich drehe und drehe und hoffe, dass mich keiner meiner Nachbarn beobachtet.
Als ich Tür schließlich öffne, begrüßen mich Dunkelheit und der Fernseher. Ups, hab ich doch glatt vergessen, ihn auszuschalten. Ist auch egal, ist eh alles egal.
Ich drehe den Wasserhahn auf und halte meine roten Finger unter den heißen Strahl. Das Brennen kriecht durch meinen ganzen Körper. Und aus dem Wohnzimmer der Torschrei eines Sky-Moderators, meilenweit entfernt von mir. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich nicht alleine lässt. Trotzdem nervst du mich, du hast ja keine Ahnung, ich schalte dich ab.
Und auf einmal ist es still. Und dunkel. Nein, doch nicht. Der helle Weihnachtsstern der Nachbarn leuchtet durch das Fenster.
Hallo Weihnachtswelt.
Abonnieren
Posts (Atom)