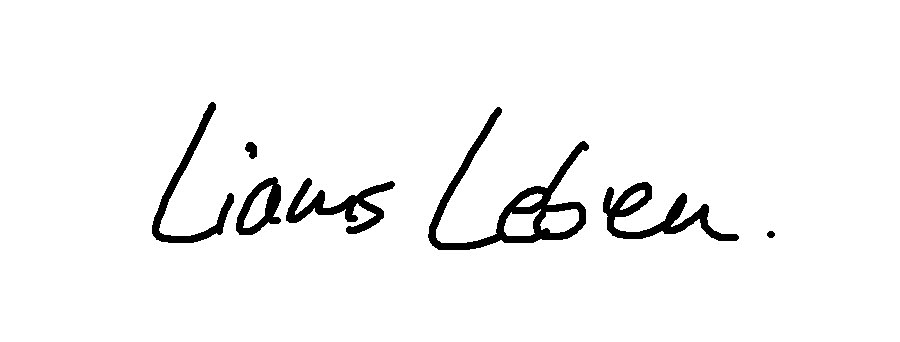Die Weggabelung der Entscheidung tut sich vor dir auf. Du verlangsamst deine Schritte, um mehr Zeit zum Denken zu haben. Zum Überlegen, welche Richtung wohl die beste ist. Zum Grübeln über diese und jene mögliche Konsequenz. Du versinkst in den Gedanken des Für und Wider, im ewigen Hin und Her. Am Ende stehst du fast. So langsam bist du geworden. Wie in Zeitlupe. Aber der Lauf des Lebens gibt dir vor, dass du nicht stehenbleiben kannst. Es geht nicht. Kein Zurück und kein Stopp. Die Kreuzung wird kommen, auch wenn du noch so langsam schleichst. Es sei denn, du springst ab. Dann ist Stopp. Aber endgültig. Kein Zurück. Das ewige Ende im endlosen Nichts. Kurz denkst du tatsächlich darüber nach. In diesen Momenten, in denen die Last der Entscheidung dich niederzudrücken scheint. Wenn alles zu viel wird, weil du verdammt nochmal einfach nicht weißt, welcher scheiß Weg der richtige ist und welcher der falsche, welcher vielleicht eine Sackgasse ist oder bei welchem sich unüberwindbare Hindernisse hinter der nächsten Kurve verbergen. Woher sollst du es auch wissen, woher? Aber nein, das ist keine wirkliche Option, ein Gedankenspiel, nichts weiter. Nicht wahr? Und in dir beginnt es zu rasen, deine Gedanken entziehen sich jeder Logik, du kannst jetzt nicht so etwas Wichtiges entscheiden, nicht jetzt! Aber du musst, du musst jetzt, denn da ist die Gabelung, du hast sie erreicht, und du biegst ab, du musst. Nach links. Vielleicht. Oder nach rechts. Wer weiß schon, wie du entscheidest.
Und kaum abgebogen drehst du auch schon den Kopf. Du schaust zurück und überdenkst diesen entscheidenden Schritt in die Richtung wieder und wieder und wieder und immer wieder laufen dir die Bilder durch den Geist. Die Kreuzung liegt schon weit hinter dir und trotzdem lässt sie dich nicht los. Deine Gedanken kreisen weiter nur um diesen Moment. So sehr, dass du den Weg nach vorne vergisst. Du fragst dich, wo du jetzt wohl stehen würdest, hättest du den anderen Pfad gewählt. Besser. Vielleicht. Oder doch schlechter. Wer weiß schon, was gewesen wäre.
Und dann brüllst du in den dunklen Wald hinein: Ich habe mich doch entschieden, verdammt! Kann mir dann nicht wenigstens einer sagen, ob es richtig war? Was für ein Scheiß! Eine Frage ohne Antwort! Ein Problem ohne Aufklärung!
Wie ein Buch, in dem das letzte Kapitel ungeschrieben bleibt. Eine unvollendete Geschichte. Es wird dich immer verfolgen, immer.
Es sei denn, du schreibst es selbst.
Sonntag, 17. August 2014
Mittwoch, 6. August 2014
Was früher mein Zuhause war.
Der Zug bremst quietschend ab, bis er im Bahnhof zum Stehen kommt. Die Türen öffnen sich und ich atme die regnerische Luft ein. Kurz muss ich mich orientieren, folge dann den wenigen Leuten, die mit mir ausgestiegen sind und verlasse den Bahnsteig. Ich biege an der Straße links ab, durch den Tunnel und dann den Fußweg entlang. Ich versinke in meinen Gedanken, aber meine Füße kennen den Weg und tragen mich über Kreuzungen, Zebrastreifen und Bürgersteige bis zu der Straßenecke, an der ich abbiegen muss. Ich verlangsame mein Tempo und tauche aus meiner Gedankenwelt auf. Die letzten Schritte lege ich langsamer zurück und ich blicke mich dabei um. Ich schaue nach links und nach rechts, betrachte die Bäume und die Straßenlaternen, die Hecken und die Gartentore der Nachbarn.
Und dann sehe ich das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Es ist mit Efeu überwachsen, so wie auch früher schon. Ein Auto steht vor der Tür, wie auch damals oft. Der Briefkasten hängt links von der Tür, der gepflasterte Weg ist gefegt und leer. Ich kenne es hier und trotzdem fühle ich mich fremd. Obwohl ich noch einen Schlüssel in der Tasche habe, klingele ich. Ich käme mir wie ein Einbrecher vor, würde ich ungefragt das Haus betreten.
Als die Tür geöffnet wird, trete ich ein. Ich sehe mich um. Irgendwie sieht alles so aus, wie ich es kenne. Die Wände sind in derselben Farbe gestrichen. Der Tisch und die Stühle sind noch die alten. Und trotzdem wirkt alles so fremd. Hier hängt ein neues Bild. Der Toaster ist neu und auch der Wasserkocher. Es liegen Dinge herum, die ich noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, während mein Blick durch das Zimmer schweift. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Frage ich nach etwas zu trinken oder hole ich es mir selber. Gehe ich aufs Gästeklo oder benutze ich die Toilette im oberen Stockwerk.
Als ich mein Handy aus der Hosentasche ziehe, um mich abzulenken und festzuhalten, wundere ich mich. Ich habe WLAN. Das Smartphone hat sich automatisch mit dem privaten Netzwerk verbunden, denn die Daten waren wohl noch eingespeichert. Ein Home-Netzwerk. Vielleicht ist das das einzige, was noch geblieben ist. Was früher mein Zuhause war, ist heute nur noch WLAN-Netz.
Und dann sehe ich das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Es ist mit Efeu überwachsen, so wie auch früher schon. Ein Auto steht vor der Tür, wie auch damals oft. Der Briefkasten hängt links von der Tür, der gepflasterte Weg ist gefegt und leer. Ich kenne es hier und trotzdem fühle ich mich fremd. Obwohl ich noch einen Schlüssel in der Tasche habe, klingele ich. Ich käme mir wie ein Einbrecher vor, würde ich ungefragt das Haus betreten.
Als die Tür geöffnet wird, trete ich ein. Ich sehe mich um. Irgendwie sieht alles so aus, wie ich es kenne. Die Wände sind in derselben Farbe gestrichen. Der Tisch und die Stühle sind noch die alten. Und trotzdem wirkt alles so fremd. Hier hängt ein neues Bild. Der Toaster ist neu und auch der Wasserkocher. Es liegen Dinge herum, die ich noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, während mein Blick durch das Zimmer schweift. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Frage ich nach etwas zu trinken oder hole ich es mir selber. Gehe ich aufs Gästeklo oder benutze ich die Toilette im oberen Stockwerk.
Als ich mein Handy aus der Hosentasche ziehe, um mich abzulenken und festzuhalten, wundere ich mich. Ich habe WLAN. Das Smartphone hat sich automatisch mit dem privaten Netzwerk verbunden, denn die Daten waren wohl noch eingespeichert. Ein Home-Netzwerk. Vielleicht ist das das einzige, was noch geblieben ist. Was früher mein Zuhause war, ist heute nur noch WLAN-Netz.
Freitag, 25. Juli 2014
Troika der Nacht.
Zu wem der Nachrichtensprecher wohl nachts noch spricht, wenn er eine Gute Nacht wünscht? Wie viele ihm da noch lauschen? Wie viele schlaflose Ohren sich lieber die Sorgen der Welt anhören und dem ganz großen Terror folgen, als sich in eigenen Albträumen zu wälzen. Wie viele schauen sich die quälenden Bilder des Krieges an, wie viele betrachten weinende Gesichter und still brennende Gedenkkerzen, anzugtragende Politiker, die sich gegenseitig schuldig sprechen. Wie schlimm muss der Film im eigenen Kopf sein, um ihn gegen solche Meldungen einzutauschen?
Wie ein Positionslicht in der dunklen Nacht leuchtet in strahlendem Gelb das Fenster auf der anderen Straßenseite. Was hinter diesem Viereck aus Licht wohl gerade so geschieht? Wer da wohl wohnt und warum er wohl die Nacht zum Tage macht?
Vielleicht lassen die Gedanken in seinem Kopf ihn nicht schlafen. Vielleicht kommt er gerade von der Arbeit oder muss so früh schon zur Schicht. Vielleicht genießt er die Einsamkeit und die Ruhe der Nacht. Vielleicht schläft er auch mit Licht, damit seine Dämonen von ihm fernbleiben. Oder er telefoniert mit einem Freund vom anderen Ende der Welt. Ob er auch auf mein erleuchtetes Zimmer schaut und einen Verbündeten erkennt? Ob er derjenige ist, an den der Nachrichtensprecher seine Worte und Bilder richtet?
Vielleicht spricht der sogar nur zu uns beiden. Vielleicht sind wir zwei die einzigen, die in der dunklen Nacht in diesem Moment diesen Sender schauen. Wir sitzen zu zweit im Publikum. Wir blicken beide nach vorne. Die Ränge der Zuschauer liegen im Dunkeln, deshalb betrachten wir einander nicht. Wir wissen nicht einmal über den anderen Bescheid. Wir wissen überhaupt nicht, dass all die Stühle unbesetzt sind. Wir wissen nicht, dass wir in diesem Moment für uns alleine sind. Wir drei. Der Nachrichtensprecher. Mein unbekannter Nachbar. Und ich. Wir kennen uns nicht. Und sind doch ein Team in dieser Welt, ein Terzett der Nacht, eine Troika in der Dunkelheit.
Wie ein Positionslicht in der dunklen Nacht leuchtet in strahlendem Gelb das Fenster auf der anderen Straßenseite. Was hinter diesem Viereck aus Licht wohl gerade so geschieht? Wer da wohl wohnt und warum er wohl die Nacht zum Tage macht?
Vielleicht lassen die Gedanken in seinem Kopf ihn nicht schlafen. Vielleicht kommt er gerade von der Arbeit oder muss so früh schon zur Schicht. Vielleicht genießt er die Einsamkeit und die Ruhe der Nacht. Vielleicht schläft er auch mit Licht, damit seine Dämonen von ihm fernbleiben. Oder er telefoniert mit einem Freund vom anderen Ende der Welt. Ob er auch auf mein erleuchtetes Zimmer schaut und einen Verbündeten erkennt? Ob er derjenige ist, an den der Nachrichtensprecher seine Worte und Bilder richtet?
Vielleicht spricht der sogar nur zu uns beiden. Vielleicht sind wir zwei die einzigen, die in der dunklen Nacht in diesem Moment diesen Sender schauen. Wir sitzen zu zweit im Publikum. Wir blicken beide nach vorne. Die Ränge der Zuschauer liegen im Dunkeln, deshalb betrachten wir einander nicht. Wir wissen nicht einmal über den anderen Bescheid. Wir wissen überhaupt nicht, dass all die Stühle unbesetzt sind. Wir wissen nicht, dass wir in diesem Moment für uns alleine sind. Wir drei. Der Nachrichtensprecher. Mein unbekannter Nachbar. Und ich. Wir kennen uns nicht. Und sind doch ein Team in dieser Welt, ein Terzett der Nacht, eine Troika in der Dunkelheit.
Mittwoch, 23. Juli 2014
Sommerzeit, Regenzeit.
Die Sonne strahlt vom Himmel, der blau und blau und nur blau ist. Kein graues Wölkchen ist zu sehen, kein Tupfer weißer Farbe auf hellblauer Pappe. Es ist heiß. Menschen schwitzen und sonnen sich, baden und lachen und freuen sich. Alle laufen in kurzen Hosen umher, tragen Kleider, Shorts und weite Tunikas. So ein glücklicher Sommertag.
Das Wasser kräuselt sich sanft im lauen Wind, es glitzert und funkelt in so magischen Farben. Und davor das strahlende Grün der Bäume und des Rasens als Kontrast. Doch der Grünton des Grases schimmert nur vereinzelt durch das Meer aus Tüchern, Decken und liegenden Körpern. Es ist, als hätte sich die ganze Stadt auf der Wiese ausgebreitet. Alle entspannen sie gemeinsam im großen Garten inmitten der asphaltierten grauen Metropole. Viele unterhalten sich, leise und für sich. Einige spielen mit ihren Kindern und Freunden, lachen und genießen. Viele sind in Pärchen und Grüppchen angereist, einige liegen auch alleine auf ihrem Fleckchen. Sie spielen am Handy. Schlafen. Beobachten. Oder lesen.
Ich lese auch.
"Wenige Minuten nach ein Uhr morgens fiel unerwartet starker Regen. Kein Donner ging der Sintflut voraus und kein Wind. So jäh und so heftig war der Guss, dass er sich ins Bewusstsein drängte wie das unheilvolle Unwetter in einem Traum. [...]
Die unzähligen Stimmen des Wolkenbruchs klangen wie eine wütende Menschenmenge, die in einer vergessenen Sprache Parolen brüllt. Die Wassermassen hämmerten an die Zedernverschalung und die Dachschindeln, als wollten sie sich Eingang verschaffen."
Die unzähligen Stimmen des Wolkenbruchs klangen wie eine wütende Menschenmenge, die in einer vergessenen Sprache Parolen brüllt. Die Wassermassen hämmerten an die Zedernverschalung und die Dachschindeln, als wollten sie sich Eingang verschaffen."
[aus Dean Koontz - Todesregen]
Montag, 21. Juli 2014
Schwankend.
Es ist nur ein Wimpernschlag zwischen Freude und Trauer. Nur ein einziges Tick des Sekundenzeigers zwischen alles wird gut und ich kann nicht mehr. Es ist nur ein Augenblick vom Aufspringen zum Fall. Nur ein klitzekleiner Spalt zwischen lebendig und taub.
Von froh zu traurig zu wütend zu stolz zu schwach zu stark zu ängstlich zu hoffnungsvoll zu einsam zu glücklich zu leer zu froh zu tot. Zickzackkurs. Karussellfahrt ohne Ende ohne Runde ohne Start.
Meine Welt schwankt von Nord zu Süd ohne Kompass und ohne Plan. Mein Leben schwankt vor und zurück und ich mittendrin. Ich schwanke und wanke hin und her. Alles wankt. Meine Stimmung schwankt.
Von froh zu traurig zu wütend zu stolz zu schwach zu stark zu ängstlich zu hoffnungsvoll zu einsam zu glücklich zu leer zu froh zu tot. Zickzackkurs. Karussellfahrt ohne Ende ohne Runde ohne Start.
Meine Welt schwankt von Nord zu Süd ohne Kompass und ohne Plan. Mein Leben schwankt vor und zurück und ich mittendrin. Ich schwanke und wanke hin und her. Alles wankt. Meine Stimmung schwankt.
Montag, 14. Juli 2014
Mein Leben in WMs.
2002:
Die erste Weltmeisterschaft, an die ich Erinnerungen habe. Ein Spielplatz, ein Radio, das Finale: Kinder, die kaum Interesse am Spiel zeigen, Eltern, die mitfiebern, hoffen, bangen, ein Gegentor, am Ende wird das Radio ganz schnell ausgestellt.
2006:
Ein Bolzplatz, Freunde, ein Ball. Wie wir selber den Idolen nacheifern, während wir uns ordentlich im Dreck wälzen, Flanken schlagen, Tore schießen, und dann ganz plötzlich Aufbruchsstimmung und ein gemeinsames Nach-Hause-Rennen, um es noch rechtzeitig zum Spiel vor den Fernseher zu schaffen. Beim Aus im Halbfinale fließen die Tränen.
2010:
Ein Spielplan, den ich vorsichtig von meiner Wand abtrenne, ist die einzige Erinnerung, die ich an diese WM noch habe, die ersten Ergebnisse sind schon eingetragen, dann ganz plötzlich der Umzug, im neuen Zimmer hängt zunächst nur dieses eine Poster, doch am Ende bleiben viele Felder unausgefüllt. Auf einmal gibt es Wichtigeres als Fußball.
2014:
Welche Momente mögen wohl von diesem Turnier im Gedächtnis bleiben? Public Viewing im strömenden Regen? Autokorsos? Bier?
Was wohl in vier Jahren die Szenen sein werden, die ich als Schnipsel der Erinnerung an diese Zeit abspeichern werde?
Samstag, 17. Mai 2014
Auf der Suche nach dem Wort.
Ich blättere durch den Duden und durch Lexika, auf der Suche nach den Worten. Und ich finde sie alle. Ich finde die Gefühle und Empfindungen, alphabetisch sortiert von A wie Angst bis Z wie Zufriedenheit. Ich finde Sätze und Satzstrukturen. Aber ich kann nichts damit anfangen, ich kann nicht zusammensetzen, was zusammengehört. Ich kann keine Worte finden für das, was in mir ist. Ich begebe mich zu allen Orten und warte dort, wo ich früher inspiriert wurde. Wo mir früher die Worte zugeflogen sind. Wo sie in mich eingedrungen sind und jedes schwarze Loch mit Buchstaben aufgefüllt haben.
Ich stehe im Regen. Und finde keine Worte dafür. Außer die, dass ich im Regen stehe. Ich fühle auch irgendwas, irgendwie ist es nass und irgendwie kleben meine Klamotten an meiner Haut, irgendwie füllen sich meine Chucks mit Wasser und irgendwie wird mir auch ein kleines bisschen kalt. Aber was sonst so in mir abgeht, was das in mir auslöst, das weiß ich nicht. Ich kann's nicht in Worte fassen. Da ist was in mir. Oder auch nicht.
Ich liege im Bett und warte auf den Schlaf. Und irgendwie kommt er nicht und irgendwie liege ich immer weiter nur so rum und irgendwie gucke ich immer wieder auf die Uhr und merke immer wieder, wie der Morgen näherkommt. Und ich weiß nicht, warum der Schlaf nicht kommen will. Wo er sich wohl gerade rumtreibt; zumindest nicht in meinem Zimmer. Aber was stattdessen in meinem Kopf abgeht, das weiß ich nicht. Das kann ich mit Worten nicht fassen. Vielleicht ist da auch nichts. Schwarz wie das Zimmer um mich herum.
Ich stehe am Flughafen und beobachte Abschiedsschmerz und Wiedersehensfreude. Ich schaue mir Menschen mit Blumen an und mit Plakaten und mit Tränen in den Augen und mit riesigen Taschen. Ich stehe abseits, ich warte auf niemanden, ich werde von niemandem erwartet. Ich bin nur stummer Zeuge der Bewegung um mich herum. Überall werden Gefühle zur Schau gestellt, aber in mir ist ein leerer Fleck auf der Gefühls-Landkarte. In mir bleibt alles stumm.
Ich sitze vor einem leeren Blatt Papier. Ich schreibe ein Wort. Ich streiche ein Wort. Ich schreibe zwei Wörter. Ich streiche zwei.
Alles klingt falsch. Alles ist schon da gewesen. In der großen weiten Welt der Worte. Ich kann nur noch kopieren und zitieren.
"Wo bleiben die guten Tage?
Ich will mich nicht beklagen.
Mein Leben ist fast, fast immer leicht
Es ist fast schon unbeschreiblich
Es läuft fast, wie es laufen soll."
[Emma6]
Ich stehe im Regen. Und finde keine Worte dafür. Außer die, dass ich im Regen stehe. Ich fühle auch irgendwas, irgendwie ist es nass und irgendwie kleben meine Klamotten an meiner Haut, irgendwie füllen sich meine Chucks mit Wasser und irgendwie wird mir auch ein kleines bisschen kalt. Aber was sonst so in mir abgeht, was das in mir auslöst, das weiß ich nicht. Ich kann's nicht in Worte fassen. Da ist was in mir. Oder auch nicht.
Ich liege im Bett und warte auf den Schlaf. Und irgendwie kommt er nicht und irgendwie liege ich immer weiter nur so rum und irgendwie gucke ich immer wieder auf die Uhr und merke immer wieder, wie der Morgen näherkommt. Und ich weiß nicht, warum der Schlaf nicht kommen will. Wo er sich wohl gerade rumtreibt; zumindest nicht in meinem Zimmer. Aber was stattdessen in meinem Kopf abgeht, das weiß ich nicht. Das kann ich mit Worten nicht fassen. Vielleicht ist da auch nichts. Schwarz wie das Zimmer um mich herum.
Ich stehe am Flughafen und beobachte Abschiedsschmerz und Wiedersehensfreude. Ich schaue mir Menschen mit Blumen an und mit Plakaten und mit Tränen in den Augen und mit riesigen Taschen. Ich stehe abseits, ich warte auf niemanden, ich werde von niemandem erwartet. Ich bin nur stummer Zeuge der Bewegung um mich herum. Überall werden Gefühle zur Schau gestellt, aber in mir ist ein leerer Fleck auf der Gefühls-Landkarte. In mir bleibt alles stumm.
Ich sitze vor einem leeren Blatt Papier. Ich schreibe ein Wort. Ich streiche ein Wort. Ich schreibe zwei Wörter. Ich streiche zwei.
Alles klingt falsch. Alles ist schon da gewesen. In der großen weiten Welt der Worte. Ich kann nur noch kopieren und zitieren.
"Wo bleiben die guten Tage?
Ich will mich nicht beklagen.
Mein Leben ist fast, fast immer leicht
Es ist fast schon unbeschreiblich
Es läuft fast, wie es laufen soll."
[Emma6]
Mittwoch, 9. April 2014
Zurück auf LOS.
Auf einmal wird alles anders. Auf einmal dreht sich die Erde so schnell. Auf einmal kommt jeden Tag eine neue Nachricht, eine neue Meldung und mein Leben dreht sich im Kreis.
Gestern hieß es noch so, heute ist es anders, morgen wird es sein wie nie zuvor.
Ich bin auf dem Weg in die eine Richtung und plötzlich - zack! - taucht etwas auf. Und das eine Wort, der eine Moment, der eine Brief, lassen mich im Sprint innehalten, lassen mich abbremsen, umdrehen, um 180 Grad oder dann vielleicht doch wieder um 360.
Wer weiß schon, wo ich landen werde. Wer will schon wissen, wo ich landen werde. Ich will es nicht. Ich plane einfach nur noch in den nächsten fünf Minuten, was soll da schon groß passieren.
Und dann kommt die eine Mail, die ein Whatsapp-Nachricht, die eine SMS, die mir sagt: "Halt! Stopp! Nochmal von vorn!"
Und dann geht's zurück auf LOS. Die Würfel werden erneut geworfen, alle Uhren zurück auf Anfang, die Zähler stehen wieder bei Null. Jeder hat wieder jede Chance, jeder hat wieder jede Möglichkeit, alles zu verlieren. Oder zu gewinnen.
Ich lege mich abends ins Bett. Und kann nicht schlafen, weil ich all die Kehrtwendungen der letzten 24 Stunden verarbeiten muss. Weil ich alles überdenken muss. Weil ich jeder verpassten Chance nachtrauere und mich auf jede neue freue und mich gleichzeitig fürchte, denn wer weiß schon, was kommen wird. Und dann lege ich mir einen Plan zurecht, um all meine rasenden Gedanken zu ordnen. Um das Chaos ein wenig zu lichten. Um etwas zu haben, an dem ich mich orientieren kann.
Und am nächsten Morgen stehe ich auf, bin schlecht gelaunt, weil ich nicht geschlafen habe, und am Frühstückstisch werden meine Pläne wieder umgewälzt. Alles wieder neu. Ihr habt wieder neue Ideen.
Zurück auf LOS.
Ich würfel gleich nochmal. Wir fangen von vorne an, bis wir drei Sechsen haben. Das kann noch ewig dauern. Ich glaube, die Würfel sind gezinkt.
Gestern hieß es noch so, heute ist es anders, morgen wird es sein wie nie zuvor.
Ich bin auf dem Weg in die eine Richtung und plötzlich - zack! - taucht etwas auf. Und das eine Wort, der eine Moment, der eine Brief, lassen mich im Sprint innehalten, lassen mich abbremsen, umdrehen, um 180 Grad oder dann vielleicht doch wieder um 360.
Wer weiß schon, wo ich landen werde. Wer will schon wissen, wo ich landen werde. Ich will es nicht. Ich plane einfach nur noch in den nächsten fünf Minuten, was soll da schon groß passieren.
Und dann kommt die eine Mail, die ein Whatsapp-Nachricht, die eine SMS, die mir sagt: "Halt! Stopp! Nochmal von vorn!"
Und dann geht's zurück auf LOS. Die Würfel werden erneut geworfen, alle Uhren zurück auf Anfang, die Zähler stehen wieder bei Null. Jeder hat wieder jede Chance, jeder hat wieder jede Möglichkeit, alles zu verlieren. Oder zu gewinnen.
Ich lege mich abends ins Bett. Und kann nicht schlafen, weil ich all die Kehrtwendungen der letzten 24 Stunden verarbeiten muss. Weil ich alles überdenken muss. Weil ich jeder verpassten Chance nachtrauere und mich auf jede neue freue und mich gleichzeitig fürchte, denn wer weiß schon, was kommen wird. Und dann lege ich mir einen Plan zurecht, um all meine rasenden Gedanken zu ordnen. Um das Chaos ein wenig zu lichten. Um etwas zu haben, an dem ich mich orientieren kann.
Und am nächsten Morgen stehe ich auf, bin schlecht gelaunt, weil ich nicht geschlafen habe, und am Frühstückstisch werden meine Pläne wieder umgewälzt. Alles wieder neu. Ihr habt wieder neue Ideen.
Zurück auf LOS.
Ich würfel gleich nochmal. Wir fangen von vorne an, bis wir drei Sechsen haben. Das kann noch ewig dauern. Ich glaube, die Würfel sind gezinkt.
Montag, 3. März 2014
Interpretation.
Wie ein Gedicht interpretieren wir die Menschen. Aus dem, was sie sagen, schließen wir auf das zwischen den Zeilen. Aus dem, wie sie ihre Augen verdrehen, schließen wir auf das in ihren Köpfen.
Manchmal bedeutet ein "vielleicht" nur ein "vielleicht". Nicht nein und auch nicht ja. Nicht "ich mag dich nicht" und auch nicht "ich habe keine Zeit". Es heißt einfach nur ja oder nein, ich weiß noch nicht, ich kann mich noch nicht entscheiden, wir werden sehen.
Manchmal bedeutet "nein" wirklich NEIN!
Manchmal meint man mit "ja" wirklich JA, ICH WILL, auch wenn das Lächeln gerade nicht so leicht über die Lippen kommt. Auch wenn die Stimme nicht so fröhlich klingt und die Augen nicht so strahlend grinsen, wie es der Gegenüber gerne hätte. Manchmal ist lächeln nicht so leicht.
Auch hinter Ironie steckt mal ein wahrer Kern. Aber nicht immer.
Und nicht immer ist alles Ironie. Auch ein Clown spricht mal wahre Worte.
Manchmal ist keine Antwort auch keine Antwort. Es heißt nicht nein und auch nicht ja, es heißt nicht "kein Bock", es ist einfach keine Antwort. Weil die noch folgen wird. Oder auch nicht.
Manchmal ist reden so schwer. Wenn jeder nur das Ungesagte interpretiert und dabei ganz vergisst, auch mal zuzuhören. Vielleicht würden wir uns dann ja endlich mal verstehen.
Manchmal bedeutet ein "vielleicht" nur ein "vielleicht". Nicht nein und auch nicht ja. Nicht "ich mag dich nicht" und auch nicht "ich habe keine Zeit". Es heißt einfach nur ja oder nein, ich weiß noch nicht, ich kann mich noch nicht entscheiden, wir werden sehen.
Manchmal bedeutet "nein" wirklich NEIN!
Manchmal meint man mit "ja" wirklich JA, ICH WILL, auch wenn das Lächeln gerade nicht so leicht über die Lippen kommt. Auch wenn die Stimme nicht so fröhlich klingt und die Augen nicht so strahlend grinsen, wie es der Gegenüber gerne hätte. Manchmal ist lächeln nicht so leicht.
Auch hinter Ironie steckt mal ein wahrer Kern. Aber nicht immer.
Und nicht immer ist alles Ironie. Auch ein Clown spricht mal wahre Worte.
Manchmal ist keine Antwort auch keine Antwort. Es heißt nicht nein und auch nicht ja, es heißt nicht "kein Bock", es ist einfach keine Antwort. Weil die noch folgen wird. Oder auch nicht.
Manchmal ist reden so schwer. Wenn jeder nur das Ungesagte interpretiert und dabei ganz vergisst, auch mal zuzuhören. Vielleicht würden wir uns dann ja endlich mal verstehen.
Sonntag, 2. März 2014
Die Taucherglocke.
Wie eine Taucherglocke, die über meinen Kopf gezogen wurde, hören sich die Geräusche plötzlich so gedämpft an. Meine Freunde lachen auf einmal viel leiser. Ihre Worte dringen kaum noch zu mir durch. Es fällt mir schwer, mich auf einzelne Worte zu konzentrieren. Alles ist nur noch eine Mischung aus Worten, Lachen, Stühlerücken und Gläserklirren. Es ist alles wahnsinnig laut, weil meine Taucherglocke den Schall verstärkt, und doch alles so leise, weil kaum etwas unter das harte Glas dringt.
Durch die Taucherglocke sehe ich alles nur noch verschwommen. Die Farben scheinen mir nicht mehr so klar. Die Menschen ähneln sich auf einmal alle. Die Buchstaben in der Speisekarte sind nur noch schwarze Schlieren, die ich kaum entziffern kann. Und gleichzeitig würde ich am liebsten meine Augen verschließen vor all dem grellen Licht, das in den Räumen brennt.
Es ist eine Mischung aus Angst davor, jemand könnte merken, was mit mir los ist, und Wut auf die verdammte Taucherglocke, die ganz plötzlich an mir klebt. Die Verbindung beider Gefühle lässt meinen Bauch verkrampfen und versetzt den Rest meines Körpers in Anspannung.
Ich versuche, mich auf Einfaches zu konzentrieren. Ich zähle gedanklich bis zehn. Ich fixiere meine Augen auf einen Punkt an der Wand. Ich höre auf jedes einzelne Wort der Musik im Hintergrund.
Und währenddessen warte ich darauf, dass der Abend zu Ende geht, oder die Taucherglocke ganz plötzlich wieder verschwindet.
Durch die Taucherglocke sehe ich alles nur noch verschwommen. Die Farben scheinen mir nicht mehr so klar. Die Menschen ähneln sich auf einmal alle. Die Buchstaben in der Speisekarte sind nur noch schwarze Schlieren, die ich kaum entziffern kann. Und gleichzeitig würde ich am liebsten meine Augen verschließen vor all dem grellen Licht, das in den Räumen brennt.
Es ist eine Mischung aus Angst davor, jemand könnte merken, was mit mir los ist, und Wut auf die verdammte Taucherglocke, die ganz plötzlich an mir klebt. Die Verbindung beider Gefühle lässt meinen Bauch verkrampfen und versetzt den Rest meines Körpers in Anspannung.
Ich versuche, mich auf Einfaches zu konzentrieren. Ich zähle gedanklich bis zehn. Ich fixiere meine Augen auf einen Punkt an der Wand. Ich höre auf jedes einzelne Wort der Musik im Hintergrund.
Und währenddessen warte ich darauf, dass der Abend zu Ende geht, oder die Taucherglocke ganz plötzlich wieder verschwindet.
Samstag, 1. März 2014
Demütige mich.
Demütige mich. Es macht mir wirklich nichts aus. Ich bin ja so stark, mir kannst du es ruhig geben. Ich bin ja immer so selbstbewusst, das stört mich absolut nicht.
Mach mich runter und morgen werde ich nicht mehr dran denken. Das ist wirklich nur eine Kleinigkeit für mich. Nichts, was mich beschäftigt. Nichts, was mich in meinen Träumen verfolgen wird.
Erniedrige mich vor allen anderen, ich verbeuge mich vor deiner Vorstellung. Ich lächle dich an und grinse in mich hinein. Ich warte auf den Applaus unserer genialen Show.
Entwürdige mich, scheiß auf Menschenwürde, scheiß auf Gleichberechtigung, das gilt nicht für mich. Ich kann auch ohne Anerkennung - brauch ich wirklich nicht!
Demütige mich. Ich verspüre nur einen Hauch von Wut und bin auch nur ein klitzekleines bisschen enttäuscht. Ich würde dir gerne nur ein wenig in die Fresse schlagen, sodass du nur ein wenig Schmerzen hast, dich nur so richtig leicht verletzt.
Ich bin so demütig. Komm, und demütige mich.
Mach mich runter und morgen werde ich nicht mehr dran denken. Das ist wirklich nur eine Kleinigkeit für mich. Nichts, was mich beschäftigt. Nichts, was mich in meinen Träumen verfolgen wird.
Erniedrige mich vor allen anderen, ich verbeuge mich vor deiner Vorstellung. Ich lächle dich an und grinse in mich hinein. Ich warte auf den Applaus unserer genialen Show.
Entwürdige mich, scheiß auf Menschenwürde, scheiß auf Gleichberechtigung, das gilt nicht für mich. Ich kann auch ohne Anerkennung - brauch ich wirklich nicht!
Demütige mich. Ich verspüre nur einen Hauch von Wut und bin auch nur ein klitzekleines bisschen enttäuscht. Ich würde dir gerne nur ein wenig in die Fresse schlagen, sodass du nur ein wenig Schmerzen hast, dich nur so richtig leicht verletzt.
Ich bin so demütig. Komm, und demütige mich.
Freitag, 28. Februar 2014
5 Nachrichten in 4 Chats.
Am Schreibtisch sitzen mit
Mathehausaufgaben und Tee, mit
Musik und Messer, an
Laptop und Handy.
Ich trinke einen Schluck.
Lasse mein Mathe-Heft zugeklappt.
Schaue auf mein Handy,
aber habe keine Kraft, zu antworten.
Ich blicke auf das Whatsapp-Symbol, auf
5 Nachrichten in 4 Chats, auf
eine neue SMS.
Und schalte mein Handy
Aus.
Ich will allein sein, nur mit mir.
Allein am Tisch sitzen.
Allein in meinem Kopf.
Allein mit mir.
Die Musik läuft und zeigt mir,
wie ich mich fühle, was ich denke,
was ich nicht sagen kann.
Bei traurigen Moll-Klängen merke ich,
wie einsam ich bin und
greife zur Klinge.
Sie ist da, sie bleibt da -
und ich kämpfe mit mir.
Drücke auf Pause.
Lege das Messer in den Schrank.
Beim nächsten Lied singe ich mit,
suche Ablenkung,
schalte mein Handy wieder ein und
antworte auf
5 Nachrichten in 4 Chats und
eine neue SMS.
Mathehausaufgaben und Tee, mit
Musik und Messer, an
Laptop und Handy.
Ich trinke einen Schluck.
Lasse mein Mathe-Heft zugeklappt.
Schaue auf mein Handy,
aber habe keine Kraft, zu antworten.
Ich blicke auf das Whatsapp-Symbol, auf
5 Nachrichten in 4 Chats, auf
eine neue SMS.
Und schalte mein Handy
Aus.
Ich will allein sein, nur mit mir.
Allein am Tisch sitzen.
Allein in meinem Kopf.
Allein mit mir.
Die Musik läuft und zeigt mir,
wie ich mich fühle, was ich denke,
was ich nicht sagen kann.
Bei traurigen Moll-Klängen merke ich,
wie einsam ich bin und
greife zur Klinge.
Sie ist da, sie bleibt da -
und ich kämpfe mit mir.
Drücke auf Pause.
Lege das Messer in den Schrank.
Beim nächsten Lied singe ich mit,
suche Ablenkung,
schalte mein Handy wieder ein und
antworte auf
5 Nachrichten in 4 Chats und
eine neue SMS.
Mittwoch, 26. Februar 2014
Die Nacht ist wach.
Das Haus liegt dunkel um mich herum, es ist still. Vereinzelt knackt es hier und da, wenn der Wind von außen gegen die Wände drückt oder die Mauern ihr Eigenleben zur Schau stellen.
Es knarzt auch, wenn ich einen Fuß vor den anderen setze. Die hölzernen Stufen ächzen unter dem Gewicht meiner Füße. Unendlich laut, so kommt es mir vor, wenn sonst alles dunkel und still ist. Langsam taste ich mich Stufe für Stufe weiter. Den Atem anhaltend, wenn die Geräusche gegen meine Ohren drücken. Aber im oberen Stockwerk bleibt alles ruhig, keine Tür wird geöffnet, keine Lichter werden entflammt.
So stehe ich in Finsternis vor der Haustür und ziehe den Schlüssel sanft aus meiner Hosentasche, behutsam darauf bedacht, die einzelnen Metallstücke nicht gegeneinanderscheppern zu lassen. Millimeter für Millimeter schiebe ich meine Hand zur Tasche und von der Tasche zum Schloss. Ich schiebe den Schlüssel in den Zylinder, langsam, ohne zu zittern.
Metall ratscht an Metall, während ich drehe und drehe. Mein Kopf ist nach oben gerichtet und hält nach der kleinsten Bewegung Ausschau. Es ist keine zu erkennen. Auch dann nicht, als die schwere Haustür mit einem schnappenden Klicken aufspringt und die kalte Luft ins Haus weht. Ich schließe die Augen und genieße den Windhauch.
Dann bücke ich mich zum Boden und greife nach meinen bereitgestellten Schuhen, ich nehme sie in die Hand und trete auf Socken nach draußen. Der steinerne Boden dringt kalt und hart durch den Stoff auf meine Sohlen. Ich spüre es, draußen zu sein, während ich mit einer Hand noch den Türgriff umklammere. Der schwerste, der lauteste Teil folgt noch. Ich muss die Tür in seine Angeln zurückziehen. Sie wird zuknallen, egal wie liebevoll ich mit ihr umgehe. Der Rahmen wird erzittern, das Schloss geräuschvoll zuschnappen.
Ich verharre einige Sekunden regungslos vor dem Haus. Als sich kein Vorhang bewegt, kein Fenster erhellt und kein Geräusch zu mir dringt, setze ich mich auf die Stufen und ziehe meine Schuhe an.
Dann nehme ich die Beine in die Hand und laufe der Nacht entgegen. Ich atme die kühle Luft, spüre den harten Boden bei jedem Schritt und sehe nur dunkle und verlassene Häuser neben mir. Die Straßen sind leer, alle Rollos runtergelassen.
Die Stadt ist tot.
Die Nacht ist wach.
Es knarzt auch, wenn ich einen Fuß vor den anderen setze. Die hölzernen Stufen ächzen unter dem Gewicht meiner Füße. Unendlich laut, so kommt es mir vor, wenn sonst alles dunkel und still ist. Langsam taste ich mich Stufe für Stufe weiter. Den Atem anhaltend, wenn die Geräusche gegen meine Ohren drücken. Aber im oberen Stockwerk bleibt alles ruhig, keine Tür wird geöffnet, keine Lichter werden entflammt.
So stehe ich in Finsternis vor der Haustür und ziehe den Schlüssel sanft aus meiner Hosentasche, behutsam darauf bedacht, die einzelnen Metallstücke nicht gegeneinanderscheppern zu lassen. Millimeter für Millimeter schiebe ich meine Hand zur Tasche und von der Tasche zum Schloss. Ich schiebe den Schlüssel in den Zylinder, langsam, ohne zu zittern.
Metall ratscht an Metall, während ich drehe und drehe. Mein Kopf ist nach oben gerichtet und hält nach der kleinsten Bewegung Ausschau. Es ist keine zu erkennen. Auch dann nicht, als die schwere Haustür mit einem schnappenden Klicken aufspringt und die kalte Luft ins Haus weht. Ich schließe die Augen und genieße den Windhauch.
Dann bücke ich mich zum Boden und greife nach meinen bereitgestellten Schuhen, ich nehme sie in die Hand und trete auf Socken nach draußen. Der steinerne Boden dringt kalt und hart durch den Stoff auf meine Sohlen. Ich spüre es, draußen zu sein, während ich mit einer Hand noch den Türgriff umklammere. Der schwerste, der lauteste Teil folgt noch. Ich muss die Tür in seine Angeln zurückziehen. Sie wird zuknallen, egal wie liebevoll ich mit ihr umgehe. Der Rahmen wird erzittern, das Schloss geräuschvoll zuschnappen.
Ich verharre einige Sekunden regungslos vor dem Haus. Als sich kein Vorhang bewegt, kein Fenster erhellt und kein Geräusch zu mir dringt, setze ich mich auf die Stufen und ziehe meine Schuhe an.
Dann nehme ich die Beine in die Hand und laufe der Nacht entgegen. Ich atme die kühle Luft, spüre den harten Boden bei jedem Schritt und sehe nur dunkle und verlassene Häuser neben mir. Die Straßen sind leer, alle Rollos runtergelassen.
Die Stadt ist tot.
Die Nacht ist wach.
Freitag, 21. Februar 2014
Am ersten schönen Tag.
Auf einer Bank sitzend, beobachte ich, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume scheinen. Wie sie Muster auf die Wege werfen und Schatten tanzen lassen. Ich blicke den Passanten ins Gesicht und lächle sie an.
Zwei Mädchen auf der gegenüberliegenden Straßenseite, an der Bushaltestelle, ihre Köpfe zusammengesteckt, über ein Smartphone gebeugt, Schultaschen in ihren Händen. Sie lachen, sie flüstern, sie reden, wer weiß schon, worüber. Und dann plötzlich haben sie es eilig, laufen los, ihre Schritte hallen über die Straße, während sie auf den Schulhof einbiegen. Pause an der Bushalte gemacht.
Eine Gruppe Fünft-, Sechst-, Siebtklässler zieht lärmend an mir vorbei - so viele, dass ich schnell aufhöre zu zählen. Vereinzelt versuchen Lehrer für Ordnung, Reih und Glied in der bunten Truppe zu sorgen.
"Hallo!", grinst mich einer im Vorbeigehen an.
"Haaaallo!", grinse ich zurück.
"Wie geht's?"
Ich antworte nicht darauf. Wozu auch. Schätze, solange es geht, ist alles ok.
Während die letzten Nachzügler noch von den allerletzten Lehrern angetrieben werden, kommt ein Mann von der anderen Seite gerannt. Er beschleunigt seine Schritte immer mehr, bis er schließlich in einen Sprint gelangt. Zu einem haltenden Bus. Der fährt an, hält wieder, öffnet die Türen und nimmt den Läufer mit. Türen wieder zu, wieder losfahren, wegfahren. Ich blicke ihm hinterher, wie er sich an parkenden Autos und Radfahrern vorbeischiebt.
Auf dem Ziffernblatt der großen Uhr steht es drei Minuten vor voll und weil ich zwar gerne noch bleiben würde, mich aber langsam beeilen muss, stehe ich auf und lasse meinen Blick noch einmal schweifen. Das Krankenhaus liegt geschäftig hinter mir, Busse, Taxen und Krankenwagen fahren vor, der Hof ist voller Ärzte, Pflegerinnen und Patienten.
Ich blicke zwischen dem lebendigen Treiben und dem Gebäude hin und her und frage mich, wer hinter den Fenstern wohl gerade um sein Leben kämpft. Welche Ärzte in diesem Moment alles geben. Wessen Herz hier heute sterben wird. Nur wenige Meter vom ersten schönen Tag des Jahres getrennt.
Zwei Mädchen auf der gegenüberliegenden Straßenseite, an der Bushaltestelle, ihre Köpfe zusammengesteckt, über ein Smartphone gebeugt, Schultaschen in ihren Händen. Sie lachen, sie flüstern, sie reden, wer weiß schon, worüber. Und dann plötzlich haben sie es eilig, laufen los, ihre Schritte hallen über die Straße, während sie auf den Schulhof einbiegen. Pause an der Bushalte gemacht.
Eine Gruppe Fünft-, Sechst-, Siebtklässler zieht lärmend an mir vorbei - so viele, dass ich schnell aufhöre zu zählen. Vereinzelt versuchen Lehrer für Ordnung, Reih und Glied in der bunten Truppe zu sorgen.
"Hallo!", grinst mich einer im Vorbeigehen an.
"Haaaallo!", grinse ich zurück.
"Wie geht's?"
Ich antworte nicht darauf. Wozu auch. Schätze, solange es geht, ist alles ok.
Während die letzten Nachzügler noch von den allerletzten Lehrern angetrieben werden, kommt ein Mann von der anderen Seite gerannt. Er beschleunigt seine Schritte immer mehr, bis er schließlich in einen Sprint gelangt. Zu einem haltenden Bus. Der fährt an, hält wieder, öffnet die Türen und nimmt den Läufer mit. Türen wieder zu, wieder losfahren, wegfahren. Ich blicke ihm hinterher, wie er sich an parkenden Autos und Radfahrern vorbeischiebt.
Auf dem Ziffernblatt der großen Uhr steht es drei Minuten vor voll und weil ich zwar gerne noch bleiben würde, mich aber langsam beeilen muss, stehe ich auf und lasse meinen Blick noch einmal schweifen. Das Krankenhaus liegt geschäftig hinter mir, Busse, Taxen und Krankenwagen fahren vor, der Hof ist voller Ärzte, Pflegerinnen und Patienten.
Ich blicke zwischen dem lebendigen Treiben und dem Gebäude hin und her und frage mich, wer hinter den Fenstern wohl gerade um sein Leben kämpft. Welche Ärzte in diesem Moment alles geben. Wessen Herz hier heute sterben wird. Nur wenige Meter vom ersten schönen Tag des Jahres getrennt.
Donnerstag, 13. Februar 2014
Erinnerungen.
Der Wind, der mir ins Gesicht weht, während ich mit meinen kurzen Beinchen in die Pedale des Kettcars trete und trotz Geschwindigkeit am Limit noch von Fußgängern überholt werde. Das krakelige Haus mit Schornstein und rotem Dach, das ich auf das vor mir liegende Papier malen muss; ich traue mich nicht, zu husten, weil ich befürchte, sonst durch den Einschulungstest zu fallen. Meine Schultüte, die ich, auf einem weißen Teppich sitzend, ausschütte. Die blaue Wand meines Zimmers, das mein Vater und ich gerade gestrichen haben. Das weißte Gartentor, hinter dem ein Hund bellt, sobald ich vorbeigehe; ich beschleunige meine Schritte jedes Mal. Die Ohrfeige, weil ich die Mathe-Hausaufgaben nicht verstehen kann oder verstehen will. Die Bühne, auf der wir aufgereiht stehen und singen, der Blick ins Publikum, die plötzliche Übelkeit, die mich zwingt, abzutreten und mich vor der Kirche auf den steinernen Boden zu setzen. Das erste Mal Busfahren ohne Karte; die Augen des Busfahrers im Spiegel; ich fühle mich beobachtet. Die Nacht vor meinem neunten Geburtstag, in der ich nicht schlafen kann und versuche, Schäfchen zu zählen. Das hölzerne Geländer, über das ich klettere, dann plötzlich das bodenlose Nichts, der freie Fall, das Liegenbleiben am Boden, das Überprüfen, ob ich mich noch bewegen kann. Der Ball, der vor meine Füße rollt und von meinen Füßen ins Tor und dann im Netz zappelt und alles jubelt und das High Five danach; mein erstes Tor. Die geweiteten Augen des Fußgängers, als ich gegen ihn fahre. Der bunte Brief in meinem Briefkasten, als ich von der Schule nach Hause komme; ich verstecke ihn in meiner Tasche und werde mit niemandem darüber reden. Die rote Note auf meiner Mappe, die nichts als Enttäuschung hinterlässt, weil ich so lange daran gearbeitet habe. Die roten Gummistiefel, mit denen ich über die Weide laufe, und versuche, die Schafe einzufangen. Das rote Notenheft und das Klavier, auf dem ich spielen soll. Die roten Krücken und wie sie mir in die laus-besetze Hecke fallen. Die blaue Schaufel, mit der mein Bruder auf mich einschlägt. Die Steiff-Dinosaurier, die wir im ganzen Haus verteilen, um uns dann gegenseitig beim Suchen anzufeuern. Die Frage, ob ich nicht lieber über Nacht bleiben wolle. Der heiße Tee, den mir die Nachtschwester ans Klappbett bringt. Das grüne Hochbett, das mit Namen und Narben verziert ist. Der dicke Bauch meiner Mutter, um den meine Arme irgendwann nicht mehr herumpassen. Der winzige Fußabdruck auf dem blauen Papier, mit dem ich nichts anfangen kann, bis mein Bruder mir die dazugehörigen winzigen Füßchen entgegenstreckt. Die zwei kleinen Jungen im Bett neben mir, deren Mutter den ganzen Tag im Zimmer bleibt. Das kalte Geländer, an dem ich mich festklammere, als ich meine ersten Schritte nach tagelangem Liegen auf den PVC-Boden setze. Der kalte Rand der Toilettenschüssel. Das Lachen der anderen in der U-Bahn. Die große blaue Tasche, die ich jedes Wochenende mit meiner dreckigen Wäsche fülle und durch Bus und Bahn nach Hause schleppe. Der Friseur, der mich fragt, ob ich mir sicher bin. Das einsame Fleckchen Erde mit einem Dach aus Ästen darüber, unter das ich mich verkrieche, sobald es zur Pause klingelt. Zu dritt auf einen Stuhl gezwängt sitzen, um Computer zu spielen. Der Swimming-Pool auf dem Bauernhof; die frische Milch dazu. Rauschende Flüsse, die am Auto vorbeiziehen, in dem wir gemeinsam singen. Die kalten Steine des Carports, auf die ich mich fallen lasse, um nicht zur Schule zu müssen. Das Polizeiauto, das mir sofort in die Augen springt, als ich die Tür öffne, und die Frage, ob meine Mutter denn auch zu Hause ist. Die Angst, nicht wieder nach Hause zu finden.
Mittwoch, 5. Februar 2014
Die Welt ist schwarz-weiß.
Manchmal ist die Welt plötzlich schwarz-weiß. Die grellen Farben verblassen und verschwimmen, bis sie nur noch in Graustufen existieren.
Was zunächst wie eine Erleichterung wirkt, wird bald zu quälender Monotonie, Melancholie legt sich wie fallender Schnee über die Erde und bedeckt alles wie ein Tuch. Mit den schimmernden Farben der Neon-Lichter und den strahlenden Blautönen lächelnder Augen verschwindet auch das Leben aus der Welt.
Wie ein kaputter Fernseher, den ich versuche zu reparieren, rauscht und rauscht und rauscht das Bild auch nach dem dritten Schlag, der auf das Gehäuse trifft. Es wird alles nur noch schlimmer, denn plötzlich verstummen auch die Geräusche. Der schwarz-weiße Film wird zum Stummfilm.
Niemand lacht mehr und niemand schreit, niemand ruft mehr meinen Namen; keine Vögel zwitschern, keine Regentropfen prasseln mehr auf das Dach.
Wie unter einem Helm, der über meinen Kopf gezogen wurde, werde ich von der Welt abgeschottet. Kein Leben dringt durch das verstärkte Visier hindurch. Kein Freund, kein Feind kann den Käfig erreichen, in dem ich mich gefangen halte.
Die graue weite Welt erstreckt sich über schwarze Felder und weiße Wiesen bis zum endlosen Horizont. In jeder Richtung ist alles Leben bloß schwarz-weiß.
Nur Blut bleibt immer rot.
Was zunächst wie eine Erleichterung wirkt, wird bald zu quälender Monotonie, Melancholie legt sich wie fallender Schnee über die Erde und bedeckt alles wie ein Tuch. Mit den schimmernden Farben der Neon-Lichter und den strahlenden Blautönen lächelnder Augen verschwindet auch das Leben aus der Welt.
Wie ein kaputter Fernseher, den ich versuche zu reparieren, rauscht und rauscht und rauscht das Bild auch nach dem dritten Schlag, der auf das Gehäuse trifft. Es wird alles nur noch schlimmer, denn plötzlich verstummen auch die Geräusche. Der schwarz-weiße Film wird zum Stummfilm.
Niemand lacht mehr und niemand schreit, niemand ruft mehr meinen Namen; keine Vögel zwitschern, keine Regentropfen prasseln mehr auf das Dach.
Wie unter einem Helm, der über meinen Kopf gezogen wurde, werde ich von der Welt abgeschottet. Kein Leben dringt durch das verstärkte Visier hindurch. Kein Freund, kein Feind kann den Käfig erreichen, in dem ich mich gefangen halte.
Die graue weite Welt erstreckt sich über schwarze Felder und weiße Wiesen bis zum endlosen Horizont. In jeder Richtung ist alles Leben bloß schwarz-weiß.
Nur Blut bleibt immer rot.
Dienstag, 4. Februar 2014
Ein Haus aus Worten.
Schwarz auf weiß stehen die Worte, in Tinte auf Papier, verewigt auf dem weißen Blatt. Jeder Buchstabe lächelt mich an und nickt mir zu. Die Punkte auf den i's starren mich wie zwinkernde Augen an. Die runden Wölbungen der e's, der u's, der a's sind Münder zu grinsenden Grimassen verzogen.
So viele Augen schauen mich an. So viele Buchstaben wollen mir etwas sagen.
Wort für Wort leiten sie mich durch die Sprache. Wort für Wort formen sich Bilder in meinem Kopf, deine Gedanken werden zu meinen Gedanken, deine Silben legen sich in meinen Mund.
Ich lese und lese und das Konstrukt aus Buchstaben, das du geschaffen hast, entsteht in meinem Inneren wieder. Jeder Buchstabe ist ein Ziegelstein, jedes Wort ein Stützpfeiler, jeder Satz ein Dach.
Von schwarz auf weiß wird es zu bunt in mir. Ich übertrage alles, eine Blaupause deiner Worte. Sie bleiben in mir, auch wenn ich deinen Brief wieder falte, wieder in den Umschlag stecke, die Druckertinte aus meinem Blickfeld verschwindet. Die Silhouette der Buchstaben geistert durch meinen Kopf. Dein Haus, mein Haus bleibt bestehen.
Aus dem Schornstein der h's quillt weißer Rauch, Wärme breitet sich in mir aus. In dem Haus in mir sitzt jemand und hat es gemütlich, genießt Gemeinsamkeit. In den Fenstern der o's brennt Licht. Lachen mischt sich mit ruhiger Freundlichkeit.
Schwarz auf weiß stehen die Worte. Und sie sind noch so viel mehr.
So viele Augen schauen mich an. So viele Buchstaben wollen mir etwas sagen.
Wort für Wort leiten sie mich durch die Sprache. Wort für Wort formen sich Bilder in meinem Kopf, deine Gedanken werden zu meinen Gedanken, deine Silben legen sich in meinen Mund.
Ich lese und lese und das Konstrukt aus Buchstaben, das du geschaffen hast, entsteht in meinem Inneren wieder. Jeder Buchstabe ist ein Ziegelstein, jedes Wort ein Stützpfeiler, jeder Satz ein Dach.
Von schwarz auf weiß wird es zu bunt in mir. Ich übertrage alles, eine Blaupause deiner Worte. Sie bleiben in mir, auch wenn ich deinen Brief wieder falte, wieder in den Umschlag stecke, die Druckertinte aus meinem Blickfeld verschwindet. Die Silhouette der Buchstaben geistert durch meinen Kopf. Dein Haus, mein Haus bleibt bestehen.
Aus dem Schornstein der h's quillt weißer Rauch, Wärme breitet sich in mir aus. In dem Haus in mir sitzt jemand und hat es gemütlich, genießt Gemeinsamkeit. In den Fenstern der o's brennt Licht. Lachen mischt sich mit ruhiger Freundlichkeit.
Schwarz auf weiß stehen die Worte. Und sie sind noch so viel mehr.
Mittwoch, 29. Januar 2014
Ziegelsteine und Beton.
Wie ein Ziegelstein in meinem Bauch.
Er quetscht meinen Magen, drückt von innen gegen meine Haut. Ich versuche, ihn auszukotzen. Aber es geht nicht. Ich versuche, ihn rauszuschneiden, aber es geht nicht. Er ist da. Und ich habe das Gefühl, er wächst. Ein wachsender, immer schwerer werdender Stein. Mir ist übel, jeden Tag. Es ist kein Ziegelstein, es ist ein Tumor-Stein. Bösartig und grausam, er greift nicht meine Zellen an, sondern mein Herz, meine Seele, mein Gehirn, das, was mich ausmacht, das, was ich bin, was mich am Leben hält.
Ich atme schwer und immer schwerer, weil er meine Organe zerquetscht, meine Lunge zermalmt, ihr den Platz zum Atmen nimmt. Manchmal habe ich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Ich habe das Gefühl, zu ersticken, auch wenn der Wind um mich in Böen weht.
Der Ziegelstein-Tumor vermehrt sich und streut kleine neue Ziegelstein-Tumoren. Sie wandern durch meinen Körper, wandern in meine Beine, die ich nicht mehr heben kann. Ich kann nicht mehr gehen, nicht mehr einen Fuß vor den anderen setzen. Meine Arme werden schwer, ich kann nicht mehr schreiben, nichts mehr greifen, sie hängen nutzlos an mir hinab.
Wie eine eiserne Fessel, die meine Knochen hält.
All die Ziegelsteine vereinen sich und werden zu einem langen Glied, das durch meinen Körper wächst. Die Kette zieht sich immer enger zu, drückt und drückt und drückt. Sie nimmt mir die Luft zum Atmen, die Freiheit zu denken, die Kraft zum Leben. Und sie bindet mich an, wie einen streunenden Hund. Ich bin ein Gefangener meiner Gedanken, ich bin mein eigener Käfig, ich komme nicht von ihm los.
Wie ein Rucksack voller Beton, den ich immer bei mir trage.
Ich wiege eine Tonne und noch mehr. Ich bin ein Elefant. Grau in grau und schwer und schwerfällig. Ich stapfe durch die Welt.
Stapf. Stapf. Stapf.
Und dann falle ich auf den Boden, alle Viere von mir gestreckt. Wie ein verendetes Tier liege ich da und bewege mich nicht.
Aber ich stehe wieder auf und ich will mich nicht beschweren. Manche tragen ein leichtes Federkleid, andere Ziegelsteine und Beton.
Er quetscht meinen Magen, drückt von innen gegen meine Haut. Ich versuche, ihn auszukotzen. Aber es geht nicht. Ich versuche, ihn rauszuschneiden, aber es geht nicht. Er ist da. Und ich habe das Gefühl, er wächst. Ein wachsender, immer schwerer werdender Stein. Mir ist übel, jeden Tag. Es ist kein Ziegelstein, es ist ein Tumor-Stein. Bösartig und grausam, er greift nicht meine Zellen an, sondern mein Herz, meine Seele, mein Gehirn, das, was mich ausmacht, das, was ich bin, was mich am Leben hält.
Ich atme schwer und immer schwerer, weil er meine Organe zerquetscht, meine Lunge zermalmt, ihr den Platz zum Atmen nimmt. Manchmal habe ich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Ich habe das Gefühl, zu ersticken, auch wenn der Wind um mich in Böen weht.
Der Ziegelstein-Tumor vermehrt sich und streut kleine neue Ziegelstein-Tumoren. Sie wandern durch meinen Körper, wandern in meine Beine, die ich nicht mehr heben kann. Ich kann nicht mehr gehen, nicht mehr einen Fuß vor den anderen setzen. Meine Arme werden schwer, ich kann nicht mehr schreiben, nichts mehr greifen, sie hängen nutzlos an mir hinab.
Wie eine eiserne Fessel, die meine Knochen hält.
All die Ziegelsteine vereinen sich und werden zu einem langen Glied, das durch meinen Körper wächst. Die Kette zieht sich immer enger zu, drückt und drückt und drückt. Sie nimmt mir die Luft zum Atmen, die Freiheit zu denken, die Kraft zum Leben. Und sie bindet mich an, wie einen streunenden Hund. Ich bin ein Gefangener meiner Gedanken, ich bin mein eigener Käfig, ich komme nicht von ihm los.
Wie ein Rucksack voller Beton, den ich immer bei mir trage.
Ich wiege eine Tonne und noch mehr. Ich bin ein Elefant. Grau in grau und schwer und schwerfällig. Ich stapfe durch die Welt.
Stapf. Stapf. Stapf.
Und dann falle ich auf den Boden, alle Viere von mir gestreckt. Wie ein verendetes Tier liege ich da und bewege mich nicht.
Aber ich stehe wieder auf und ich will mich nicht beschweren. Manche tragen ein leichtes Federkleid, andere Ziegelsteine und Beton.
Samstag, 25. Januar 2014
Der Film.
Ich sitze da und lächle, bin irgendwie zufrieden, irgendwie glücklich.
Und auf einmal beginnt ein Film in mir zu laufen. Erinnerungen schießen in meinen Kopf und spielen sich ab. Sie sind real wie immer. Ich höre die Stimmen von damals, sehe alles in 3D, rieche die Gerüche, fühle alles so wie damals. Ich kann die Bilder nicht stoppen. Ich weiß, sie laufen weiter, bis ich alles gesehen habe. Sie laufen bis zum Ende. Es ist Play ohne Stopp-Taste. Es ist ein schlechter Film mit kaputter Fernbedienung, den man nicht beenden kann. Ich kann nicht fliehen. Denn die Leinwand ist meine Kopfwand.
Als hätte mir jemand in den Magen geboxt, genauso fühle ich mich. Mir ist übel. Ich habe das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Ich möchte die Gedanken auskotzen, die sich in mir verbreiten. Ich will den Film in die Toilette spucken und dann die Spülung drücken, sehen wie das Wasser die Bilder besiegt, sie ertränkt und mit sich reißt. Weit weg von mir.
Als hätte ich Säure geschluckt, so geht es mir. Irgendwie habe ich etwas in meinem Körper, was mich von innen heraus vergiftet und verätzt. Meine Organe sind dem ausgesetzt. Ich kann sie nicht retten. Es fühlt sich an, als würde mein Herz sich zusammenziehen und verengen, es kämpft gegen den Eindringling und schlägt immer schneller, immer schmerzhafter, immer pochender. Es hallt in meinen Ohren. Bummbummbummbumm. Meine Lunge kann den Sauerstoff nicht mehr verarbeiten. Ich atme und atme und habe trotzdem Angst, zu ersticken. Ich ersticke an den Gefühlen in mir.
Als hätte mir jemand ein Messer in den Leib gerammt. So verblute ich. Innerlich.
Bis der Film ein Ende gefunden hat, bis das letzte Bild verblasst und der letzte Ton in meinem Kopf verklungen ist. Weil ich dann alles gesehen habe. Der Abspann meines Flashbacks ist aus purer Schwärze; alles, was bleibt, sind die Gefühle und die Angst.
Ich sitze immer noch genau so da, aber irgendwie bin ich nicht mehr glücklich, auf einmal geht's mir schlecht, auch wenn um mich herum alles beim Alten ist.
Und auf einmal beginnt ein Film in mir zu laufen. Erinnerungen schießen in meinen Kopf und spielen sich ab. Sie sind real wie immer. Ich höre die Stimmen von damals, sehe alles in 3D, rieche die Gerüche, fühle alles so wie damals. Ich kann die Bilder nicht stoppen. Ich weiß, sie laufen weiter, bis ich alles gesehen habe. Sie laufen bis zum Ende. Es ist Play ohne Stopp-Taste. Es ist ein schlechter Film mit kaputter Fernbedienung, den man nicht beenden kann. Ich kann nicht fliehen. Denn die Leinwand ist meine Kopfwand.
Als hätte mir jemand in den Magen geboxt, genauso fühle ich mich. Mir ist übel. Ich habe das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Ich möchte die Gedanken auskotzen, die sich in mir verbreiten. Ich will den Film in die Toilette spucken und dann die Spülung drücken, sehen wie das Wasser die Bilder besiegt, sie ertränkt und mit sich reißt. Weit weg von mir.
Als hätte ich Säure geschluckt, so geht es mir. Irgendwie habe ich etwas in meinem Körper, was mich von innen heraus vergiftet und verätzt. Meine Organe sind dem ausgesetzt. Ich kann sie nicht retten. Es fühlt sich an, als würde mein Herz sich zusammenziehen und verengen, es kämpft gegen den Eindringling und schlägt immer schneller, immer schmerzhafter, immer pochender. Es hallt in meinen Ohren. Bummbummbummbumm. Meine Lunge kann den Sauerstoff nicht mehr verarbeiten. Ich atme und atme und habe trotzdem Angst, zu ersticken. Ich ersticke an den Gefühlen in mir.
Als hätte mir jemand ein Messer in den Leib gerammt. So verblute ich. Innerlich.
Bis der Film ein Ende gefunden hat, bis das letzte Bild verblasst und der letzte Ton in meinem Kopf verklungen ist. Weil ich dann alles gesehen habe. Der Abspann meines Flashbacks ist aus purer Schwärze; alles, was bleibt, sind die Gefühle und die Angst.
Ich sitze immer noch genau so da, aber irgendwie bin ich nicht mehr glücklich, auf einmal geht's mir schlecht, auch wenn um mich herum alles beim Alten ist.
Donnerstag, 23. Januar 2014
Proundkontrawinter.
Das Doofe am Winter:
Dauernd ist mir kalt, dauernd fühle ich mich unter schichtenweise Klamotten unwohl und die Kälte kriecht trotzdem durch.
Die Straßen sind glatt und rutschig, man fällt hin, man steht wieder auf, genervt von allem.
Eisessen macht keinen Spaß.
Das Gute am Winter:
Ich trinke ganz viel Tee.
Die Luft ist so klar und so frisch und schmeckt so gut, wie nur Winterfrischluft schmecken kann.
Die Leute sind nicht so gut gelaunt, nicht so anstrengend, nicht so sommerlaunig aktiv.
Oft ist es ruhig.
Das Allerdoofeste am Winter:
Es ist grau und grau in kalter Leblosigkeit, verschneit, vereist, matschig und tot. Die Welt draußen färbt sich ab auf mich. Leblos. Kraftlos. Das Grün fehlt irgendwie an den Bäumen. Das Grün fehlt irgendwie in mir.
Das Allerallerbeste am Winter:
Er geht vorbei und dann kommt der Frühling und dann kommen die Farben und das Lachen zurück. Dann wird es draußen wieder warm, dann wird es in mir wieder warm. Dann sind die Menschen erstersonnenstrahl-glücklich und grinsen.
Dauernd ist mir kalt, dauernd fühle ich mich unter schichtenweise Klamotten unwohl und die Kälte kriecht trotzdem durch.
Die Straßen sind glatt und rutschig, man fällt hin, man steht wieder auf, genervt von allem.
Eisessen macht keinen Spaß.
Das Gute am Winter:
Ich trinke ganz viel Tee.
Die Luft ist so klar und so frisch und schmeckt so gut, wie nur Winterfrischluft schmecken kann.
Die Leute sind nicht so gut gelaunt, nicht so anstrengend, nicht so sommerlaunig aktiv.
Oft ist es ruhig.
Das Allerdoofeste am Winter:
Es ist grau und grau in kalter Leblosigkeit, verschneit, vereist, matschig und tot. Die Welt draußen färbt sich ab auf mich. Leblos. Kraftlos. Das Grün fehlt irgendwie an den Bäumen. Das Grün fehlt irgendwie in mir.
Das Allerallerbeste am Winter:
Er geht vorbei und dann kommt der Frühling und dann kommen die Farben und das Lachen zurück. Dann wird es draußen wieder warm, dann wird es in mir wieder warm. Dann sind die Menschen erstersonnenstrahl-glücklich und grinsen.
Donnerstag, 16. Januar 2014
Musik in dir.
Du schließt die Augen. Und hörst die Musik. Sie ist in dir. Sie durchflutet dich. Sie zeigt dir, was du fühlst. Sie ist perfekt. Weil sie so unfertig ist. Da sind Pausen zwischen, Lücken, Notensprünge, die du nicht einordnen kannst, die es so nicht geben kann und nie geben wird. Klangfarben, die auf keinem Instrument gespielt werden können. Es ist laut. Und es ist leise. Zugleich.
Du kannst die Töne nicht greifen, sie bleiben nicht. Kaum hörst du etwas Wundervolles, verklingen die Akkorde und etwas Neues beginnt. Nichts bleibt bestehen. Außer die ewige Melodie.
Und vor deinem inneren Auge bauen sich Bilder auf. Bilder von dir, wie du rennst. Bilder von dir, wie du stehst. Bilder von dir, wie du lächelst, wie du weinst, wie du denkst, wie du wütend bist, wie du einfach nur dasitzt und deinem Atem lauschst
Das bist du jetzt. Mit geschlossenen Augen. Und alles ist still. Der letzte laute Schlussakkord deines Orchesters verklingt, nur das rhythmische Klicken des Metronoms bleibt. Bis du die Augen öffnest und realisierst, das ist die Uhr. Tick. Tack. Tick. Tack.
Du kannst die Töne nicht greifen, sie bleiben nicht. Kaum hörst du etwas Wundervolles, verklingen die Akkorde und etwas Neues beginnt. Nichts bleibt bestehen. Außer die ewige Melodie.
Und vor deinem inneren Auge bauen sich Bilder auf. Bilder von dir, wie du rennst. Bilder von dir, wie du stehst. Bilder von dir, wie du lächelst, wie du weinst, wie du denkst, wie du wütend bist, wie du einfach nur dasitzt und deinem Atem lauschst
Das bist du jetzt. Mit geschlossenen Augen. Und alles ist still. Der letzte laute Schlussakkord deines Orchesters verklingt, nur das rhythmische Klicken des Metronoms bleibt. Bis du die Augen öffnest und realisierst, das ist die Uhr. Tick. Tack. Tick. Tack.
Mittwoch, 15. Januar 2014
Gefragt.
"Ein neues Leben kannst du nicht anfangen, aber täglich einen neuen Tag."
[Henry David Thoreau]
Ich tagge nichts und niemanden, aber, wie versprochen, antworte ich auf deine Fragen, weakheart!
[Henry David Thoreau]
Ich tagge nichts und niemanden, aber, wie versprochen, antworte ich auf deine Fragen, weakheart!
1. Wann warst du das letzte Mal glücklich?
Heute irgendwann, im Laufe des Tages
2. Wolltest du dich schon einmal umbringen?
Ja
Ja
3. Denkst du viel über unsere Gesellschaft nach?
Das ist relativ, aber ich denke generell viel nach, über alles und jeden - also ja, auch über unsere Gesellschaft
Das ist relativ, aber ich denke generell viel nach, über alles und jeden - also ja, auch über unsere Gesellschaft
4. Hättest du einen Wunsch frei, wie würde der aussehen?
Zufrieden sein
Zufrieden sein
5. Wie ist das Verhältnis zu deiner Familie?
Meine Familie besteht aus mehreren Teilen; zu manchen Teilen gut, zu manchen so lala
6. Falls du in einer ES bist, was war dein niedrigster BMI?
Nein
Nein
7. Warst du schon einmal auf einem Festival?
Nein
Nein
8. Würdest du etwas in deinem Leben rückgängig machen? Wenn ja, was?
Sicherlich. Ich hätte ein paar Menschen weniger belogen, ein paar Menschen weniger verletzt, wäre ein bisschen entschlossener gewesen, hätte mehr auf mein Herz gehört. Aber das Leben läuft eben nicht rückwärts. Und das ist auch ok so.
Sicherlich. Ich hätte ein paar Menschen weniger belogen, ein paar Menschen weniger verletzt, wäre ein bisschen entschlossener gewesen, hätte mehr auf mein Herz gehört. Aber das Leben läuft eben nicht rückwärts. Und das ist auch ok so.
9. Sprichst du mit deinen Freunden über deine Gefühle, Ängste?
Nein, eher weniger
Nein, eher weniger
10. Wie würdest du deinen Kleidungsstil beschreiben?
Jeans und T-Shirt (+ Sweatjacke)
Jeans und T-Shirt (+ Sweatjacke)
11. Hast du Piercings, Tattoos und/oder Tunnel? Wenn ja, was für welche?
Nein
Dienstag, 14. Januar 2014
Was Glück braucht.
Vielleicht braucht Glück Mut.
Vielleicht ist dieser eine letzte Schritt notwendig, dieser eine Moment des Aufbruchs. Die Flucht aus dem Alltäglichen, die Suche nach etwas Neuem.
Eine Überwindung, ein kleiner Kick, der die Lawine des Glücks anstößt. Die einen dann unaufhaltsam überrollt. Die einen verschlingt. Mit nichts als Euphorie, strahlendem Lächeln, Bauchkribbeln und dem Gefühl, die Freude in die Luft schreien zu wollen.
Vielleicht braucht Glück Erfolge.
Vielleicht nicht die großen, riesigen Schritte, vielleicht nicht die besten Noten, vielleicht nicht den ersten Platz. Aber etwas, worauf man stolz sein kann. Etwas, was zufrieden macht. Was das Gefühl gibt, das Richtige getan zu haben.
Ein aufmunterndes Wort, was Tränen getrocknet hat. Eine Anstrengung, die sich gelohnt hat. Ein Weg, der zum Ziel geführt hat.
Vielleicht braucht Glück den Zufall.
Vielleicht ist es egal, was man tut. Vielleicht zählt das alles nicht. Vielleicht kommt Glück von heut auf morgen, von hier und dort, zu diesem und jenem.
Man muss nur zur richtigen Stelle am richtigen Ort stehen, das Richtige denken und das Richtige tun. Zufällig.
Wenn das so ist, dann braucht Glück vor allem Glück.
Vielleicht ist dieser eine letzte Schritt notwendig, dieser eine Moment des Aufbruchs. Die Flucht aus dem Alltäglichen, die Suche nach etwas Neuem.
Eine Überwindung, ein kleiner Kick, der die Lawine des Glücks anstößt. Die einen dann unaufhaltsam überrollt. Die einen verschlingt. Mit nichts als Euphorie, strahlendem Lächeln, Bauchkribbeln und dem Gefühl, die Freude in die Luft schreien zu wollen.
Vielleicht braucht Glück Erfolge.
Vielleicht nicht die großen, riesigen Schritte, vielleicht nicht die besten Noten, vielleicht nicht den ersten Platz. Aber etwas, worauf man stolz sein kann. Etwas, was zufrieden macht. Was das Gefühl gibt, das Richtige getan zu haben.
Ein aufmunterndes Wort, was Tränen getrocknet hat. Eine Anstrengung, die sich gelohnt hat. Ein Weg, der zum Ziel geführt hat.
Vielleicht braucht Glück den Zufall.
Vielleicht ist es egal, was man tut. Vielleicht zählt das alles nicht. Vielleicht kommt Glück von heut auf morgen, von hier und dort, zu diesem und jenem.
Man muss nur zur richtigen Stelle am richtigen Ort stehen, das Richtige denken und das Richtige tun. Zufällig.
Wenn das so ist, dann braucht Glück vor allem Glück.
Sonntag, 12. Januar 2014
Was vom Träumen übrig bleibt.
Ich schlage die Augen auf. Durch die geöffneten Vorhänge strömt Licht in mein Zimmer. Die Januarsonne strahlt und strahlt und feuert all ihre Wärme ab. Es ist ein schöner Morgen, es wird ein schöner Tag.
Und ich liege hier und bewege mich nicht. Ich schaffe es nicht, die Schönheit des Morgens zu realisieren. Alles, was ich empfinde, sind die Reste der Träume, die noch an mir kleben. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich weiß nicht, wo ich in der Nacht gewesen bin, in welchem Teil meines Kopfes ich unterwegs war. Ich weiß nur, dass es anstrengend gewesen sein muss.
Mein Körper fühlt sich an wie nach einem Marathon. Ich fühle mich ausgelaugt und erschöpft. Ich spüre so ein ungutes Gefühl in meinem Magen, als würde ich verfolg werden, als hätte ich Angst, als wäre etwas los, als müsste ich etwas fürchten.
Und ich richte mich schlagartig auf. Mein Bett ist durchwühlt. Mein Körper schweißnass. Ich habe Angst. Und ich weiß nicht, wovor. Ich bin gerannt, aber ich weiß nicht, wohin.
Ich presse mir mein Kissen auf den Kopf und versuche, mich zu beruhigen. Ich versuche, mir einzureden, dass alles gut ist. Dass ich im Bett liege. Dass ich mich nicht fürchten muss. Aber es nützt nichts. Mein Kopf ist anderer Meinung.
Also stehe ich auf und schaue auf die Uhr. Ich habe acht Stunden geschlafen. Eigentlich müsste ich zufrieden sein, müsste ich wach sein, frisch und erholt. Aber es ist nicht so.
Auch wenn mein Körper die letzten Stunden im Bett lag und ausgeschaltet war, mein Kopf war es nicht. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber geschlafen hat er nicht.
Unter der Dusche versuche ich, mich zu konzentrieren. Es muss doch möglich sein, mich zu erinnern! Wenn ich schon mit Kopfschmerzen aufwache, wenn mein Schlaf schon ein verdammter Wettlauf ist, wenn ich schon Angst habe, dann will ich wenigstens wissen, wovor!
Aber bis es soweit ist, bis ich mich erinnern kann, ist alles, was vom Träumen übrig bleibt, Angst und Ungewissheit.
Abonnieren
Posts (Atom)