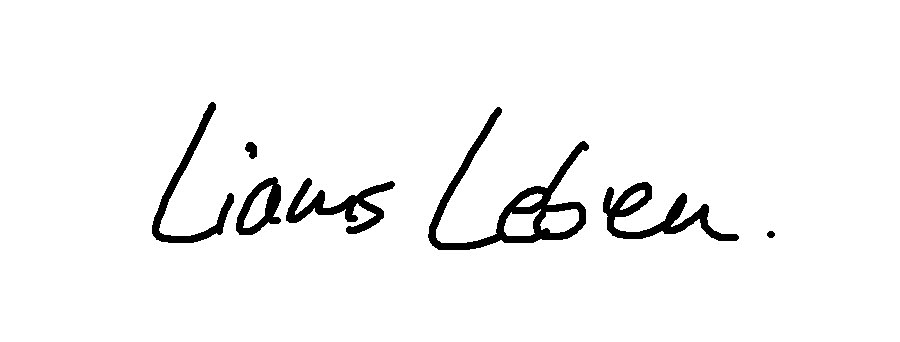Kinder lachen. Brüllen. Rennen durch den Garten.
Kinder leben.
Kinder
reichen mir bis zum Bauchnabel.
Um Zentimeter kleiner, um Erfahrungen ärmer.
So wenig in ihren runden Kugelköpfen.
Und doch stellen sie so viele
Fragen.
Fragen, die die Welt erklären.
Antworten, mangelhaft.
Die ehrlichsten der Philosophen.
Naiv und doch nicht
dumm.
Jung, zerbrechlich.
Weltverbesserer, Superhelden, Menschenretter,
Ehrlichkeitsgewinner.
Kleiner Entdecker,
wo willst du hin?
Träumst von der Welt der Erwachsenen,
ohne sie zu kennen.
Leben - ohne um acht ins Bett.
Leben - genug Geld für alle Spielzeugautos.
Leben - unbeschwert.
Ob wohl,
in ein paar Jahren,
wenn du merkst, dass die Fragen, die du heute laufend stellst,
im Sande verlaufen,
dein Entdeckerfreudengeist versiegt?
Wirst du,
während du heute mit Holzschwertern jeden Streit auskämpfst,
in ein paar Jahren,
vor Liebeskummer und Einsamkeit
in Dunkelheit versinken?
In ein paar Jahren,
die dir heute wie millionentrilliardenmegavieltausend vorkommen,
wirst du die Zeit mit anderen Augen sehen,
werden Tage viel schneller vergehen,
wird der Gedanke an morgen immer gegenwärtig sein.
Was wohl aus dem starken Ritter in
Undurchdringbar-Stoff-Kettenhemd
geworden ist,
der jetzt Texte schreibt und Kinderlachen lauscht,
in den paar Jahren?
Donnerstag, 30. August 2012
Mittwoch, 29. August 2012
Seltsam, im Nebel zu wandern.
So vieles hängt unausgesprochen zwischen uns wie eine Wand aus Nebel.
Ich kann dich zwar sehen; weiß, wo du stehst. Aber die Details bleiben verborgen. In deine Augen kann ich nicht blicken; weiß nicht, wie es dir geht.
Drehst du mir den Rücken zu oder ist das deine Vorderseite?
Lachst du? Redest du? - Deine Worte dringen nicht durch den dicken Schleier aus grau.
Und jeden Tag wird der Nebel dichter.
Immer wieder rufe ich mir die Erinnerungen an dich in den Geist. Deine Haare. Deine Augen. Deinen Mund, wenn du lächelst. Ich will es nicht vergessen. Werd ich es je wieder sehen?
Wird die graue Wand sich je wieder lichten?
Werden wir aus den ungeordneten, niemals benutzten Worten Sätze formen können und einander wieder erkennen?
Ich versuche es.
Immer wieder greife ich planlos in den Schleier, picke Worte heraus, versuche Texte zu bilden, Gedanken zu formen:
Einsamkeit
Angst
Verlust
Dankbarkeit
ich
du
wir
Freundschaft
Sehnsucht
miteinander
auseinander
Labyrinth
Weiterentwicklung
Akzeptanz
Hoffnung
Eine Kollektion dessen, was ich schon aus dem Nebel gefischt habe. Empfindungen, Pronomen, Adjektive. All das muss verknüpft werden, es muss Sinn machen, es muss etwas aussagen; stark sein und doch nichts auslassen.
Jedes Mal gebe ich resigniert auf.
Immer wenn ich ein Wort in der Hand halte und versuche, damit etwas anzufangen, merke ich gleichzeitig, wie sich der Schleier mit neuem Unausgesprochenen füllt.
Wir reden nicht.
Die Worte wollen sich nicht zusammensetzen lassen. Sie ergeben Sinn, aber klingen so leer. So falsch. So nichtssagend.
Dabei könnte es so einfach sein:
Ich danke dir für die Zeit, die wir hatten. Ich sehne mich danach. Nach dir, nach uns. Fühle mich einsam, weil das 'ich' ohne 'wir' steht. Wir verlieren uns, immer weiter, im weit verzweigten Labyrinth des Lebens. Jeder geht seinen eigenen Weg, nicht mehr miteinander. Wir entwickeln uns weiter, in unterschiedliche Richtungen. Die Zeit reißt uns auseinander, wir reißen uns selbst auseinander. Das akzeptiere ich. Trotzdem bin ich traurig darüber. Ich vermisse die wundervolle Zeit mit dir.
Ob sich unsere Wege wohl jemals wieder kreuzen werden? Ob ich es hoffen sollte? Oder würde das eh nichts bringen?
Wir haben uns nichts zu sagen, obwohl doch fast alles unausgesprochen ist.
"Und manche waren nie mehr gesehen.
Und ich frage mich, wo sie heut sind.
Auch wenn ich uns manchmal vermiss,
Es war gut wie's war, und es ist gut wie's ist.
Denn es gibt kein gemeinsames Ziel.
Jeder geht seinen eigenen Weg.
Wir nehmen's hin, bleiben stumm dabei,
Weil uns nichts anderes übrig bleibt."
[Die Toten Hosen]
Ich kann dich zwar sehen; weiß, wo du stehst. Aber die Details bleiben verborgen. In deine Augen kann ich nicht blicken; weiß nicht, wie es dir geht.
Drehst du mir den Rücken zu oder ist das deine Vorderseite?
Lachst du? Redest du? - Deine Worte dringen nicht durch den dicken Schleier aus grau.
Und jeden Tag wird der Nebel dichter.
Immer wieder rufe ich mir die Erinnerungen an dich in den Geist. Deine Haare. Deine Augen. Deinen Mund, wenn du lächelst. Ich will es nicht vergessen. Werd ich es je wieder sehen?
Wird die graue Wand sich je wieder lichten?
Werden wir aus den ungeordneten, niemals benutzten Worten Sätze formen können und einander wieder erkennen?
Ich versuche es.
Immer wieder greife ich planlos in den Schleier, picke Worte heraus, versuche Texte zu bilden, Gedanken zu formen:
Einsamkeit
Angst
Verlust
Dankbarkeit
ich
du
wir
Freundschaft
Sehnsucht
miteinander
auseinander
Labyrinth
Weiterentwicklung
Akzeptanz
Hoffnung
Eine Kollektion dessen, was ich schon aus dem Nebel gefischt habe. Empfindungen, Pronomen, Adjektive. All das muss verknüpft werden, es muss Sinn machen, es muss etwas aussagen; stark sein und doch nichts auslassen.
Jedes Mal gebe ich resigniert auf.
Immer wenn ich ein Wort in der Hand halte und versuche, damit etwas anzufangen, merke ich gleichzeitig, wie sich der Schleier mit neuem Unausgesprochenen füllt.
Wir reden nicht.
Die Worte wollen sich nicht zusammensetzen lassen. Sie ergeben Sinn, aber klingen so leer. So falsch. So nichtssagend.
Dabei könnte es so einfach sein:
Ich danke dir für die Zeit, die wir hatten. Ich sehne mich danach. Nach dir, nach uns. Fühle mich einsam, weil das 'ich' ohne 'wir' steht. Wir verlieren uns, immer weiter, im weit verzweigten Labyrinth des Lebens. Jeder geht seinen eigenen Weg, nicht mehr miteinander. Wir entwickeln uns weiter, in unterschiedliche Richtungen. Die Zeit reißt uns auseinander, wir reißen uns selbst auseinander. Das akzeptiere ich. Trotzdem bin ich traurig darüber. Ich vermisse die wundervolle Zeit mit dir.
Ob sich unsere Wege wohl jemals wieder kreuzen werden? Ob ich es hoffen sollte? Oder würde das eh nichts bringen?
Wir haben uns nichts zu sagen, obwohl doch fast alles unausgesprochen ist.
"Und manche waren nie mehr gesehen.
Und ich frage mich, wo sie heut sind.
Auch wenn ich uns manchmal vermiss,
Es war gut wie's war, und es ist gut wie's ist.
Denn es gibt kein gemeinsames Ziel.
Jeder geht seinen eigenen Weg.
Wir nehmen's hin, bleiben stumm dabei,
Weil uns nichts anderes übrig bleibt."
[Die Toten Hosen]
Mittwoch, 22. August 2012
Unendlich glückliche Spielchen.
Unter mir der Asphalt.
Neben mir Bäume. Rechts. Links.
Ich rausche an der Welt vorbei.
Rechtskurve.
Linkskurve.
Der Wind versucht mich nach rechts zu drängen, aber ich lasse mich nicht bewegen. Ich will geradeaus - dem Straßenverlauf folgen -, da hat niemand anderes gegen mich zu sein.
Trotzdem lasse ich mich auf das Spiel der Böen ein. Ich drehe mich nach rechts, tue so, als würde der Wind neben dem tosenden Rauschen der Blätter auch mich bewegen können.
Doch kurz darauf greife ich an: Fahre ganz bis auf die linke Straßenseite.
"Gewonnen!", lache ich in das Nichts hinein.
Ich grinse und euphorisiert von meinen Spielchen mit dem unsichtbaren Partner gebe ich noch mehr Gas.
Zwar hat mein Körper schon vor einigen Kilometern versucht, mir deutlich zu machen, dass ich nicht mehr kann, doch darauf habe ich nicht gehört. Und jetzt werden auch die zweifelnden Stimmen in mir leiser.
Selbst sie werden von dem Gefühl unendlichen Glücks, das sich immer weiter in mir ausbreitet, erfüllt. Es ist jedem Teil von mir jetzt unmöglich, zu sprechen. Nur lächeln, strahlen, was die Sonne am Ende des Tages nicht mehr tut, und weiter einen Fuß vor den anderen setzen.
Rasen. Schnell sein. Alles an mir vorbeiziehen lassen und wissen: Ich bin ein Teil davon.
Außer mir ist keiner hier. Nur ich und mein Freund, der Wind.
Niemand, der den Platz auf der Straße beansprucht.
Niemand, der mich durch Blicke und nicht ausgesprochene Erwartungen in eine Richtung lenkt.
Ich bin frei, alles zu tun, weil niemand mich kontrolliert.
Und doch gebunden an alles, weil ich Teil des Lebens bin.
Neben mir Bäume. Rechts. Links.
Ich rausche an der Welt vorbei.
Rechtskurve.
Linkskurve.
Der Wind versucht mich nach rechts zu drängen, aber ich lasse mich nicht bewegen. Ich will geradeaus - dem Straßenverlauf folgen -, da hat niemand anderes gegen mich zu sein.
Trotzdem lasse ich mich auf das Spiel der Böen ein. Ich drehe mich nach rechts, tue so, als würde der Wind neben dem tosenden Rauschen der Blätter auch mich bewegen können.
Doch kurz darauf greife ich an: Fahre ganz bis auf die linke Straßenseite.
"Gewonnen!", lache ich in das Nichts hinein.
Ich grinse und euphorisiert von meinen Spielchen mit dem unsichtbaren Partner gebe ich noch mehr Gas.
Zwar hat mein Körper schon vor einigen Kilometern versucht, mir deutlich zu machen, dass ich nicht mehr kann, doch darauf habe ich nicht gehört. Und jetzt werden auch die zweifelnden Stimmen in mir leiser.
Selbst sie werden von dem Gefühl unendlichen Glücks, das sich immer weiter in mir ausbreitet, erfüllt. Es ist jedem Teil von mir jetzt unmöglich, zu sprechen. Nur lächeln, strahlen, was die Sonne am Ende des Tages nicht mehr tut, und weiter einen Fuß vor den anderen setzen.
Rasen. Schnell sein. Alles an mir vorbeiziehen lassen und wissen: Ich bin ein Teil davon.
Außer mir ist keiner hier. Nur ich und mein Freund, der Wind.
Niemand, der den Platz auf der Straße beansprucht.
Niemand, der mich durch Blicke und nicht ausgesprochene Erwartungen in eine Richtung lenkt.
Ich bin frei, alles zu tun, weil niemand mich kontrolliert.
Und doch gebunden an alles, weil ich Teil des Lebens bin.
Freie Platzwahl.
Wir sitzen zusammen im Vierer.
Der Zug rauscht durch den Regen. Immer mehr nähern wir uns der Endhaltestelle. Wo wir aussteigen müssen. Wo ich weiter meinen eigenen Weg gehen kann. Worauf ich mich freue.
Ich fühle mich fremd bei euch.
Konzentriert betrachte ich mein Handy. Schreibe eine unheimlich wichtige SMS. Spiele unheimlich wichtige Spiele. Ich klammere mich fest an diesem Gegenstand. Er ist mein sicherer Anker, der mich in eurer Welt nicht untergehen lässt.
Ihr unterhaltet euch.
Ihr lacht.
Macht Späße.
Ich sollte meinen Platz räumen. Jemand anderes gehört dorthin.
Jemand, der sich mit euch unterhält.
Der mit euch lacht.
Späße macht.
Das würdet ihr nicht sagen. Wahrscheinlich denkt ihr das noch nicht mal.
Der einzige, der mich ausgrenzt, bin ich selbst.
Ich blicke mich im Zug um.
Dahinten ist noch ein Vierer mit Leuten aus unserem Kurs. Jetzt sehne ich mich in diesen, doch würde ich dort sitzen, würde ich mich genauso fremd fühlen.
Eine Zweier-Reihe könnte ich auch für mich alleine beanspruchen. Da könnte ich nicht in den Gesprächen, dem Leben untergehen. Auch würde ich mich nicht einsamer fühlen als mit euch neben mir. Trotzdem wäre es falsch, mich aus der Gruppe zu ziehen.
Also bleibe ich in eurem Vierer, lausche euren Gesprächen und Späßen und tue so, als wäre ich mit meinem Handy beschäftigt.
Ich blicke aus dem Fenster, beobachte, wie die dicken Regentropfen daran runterlaufen.
Endlos fallen.
Endlos frei sein.
Und dann der harte Aufprall, die Vereinigung mit anderen Tropfen, die den gleichen Weg hinter sich haben.
Vielleicht werde ich meinen Platz dort draußen finden.
"Es gibt einen Platz, den du füllen musst, den niemand sonst füllen kann, und es gibt etwas für dich zu tun, das niemand sonst tun kann."
[Platon]
Der Zug rauscht durch den Regen. Immer mehr nähern wir uns der Endhaltestelle. Wo wir aussteigen müssen. Wo ich weiter meinen eigenen Weg gehen kann. Worauf ich mich freue.
Ich fühle mich fremd bei euch.
Konzentriert betrachte ich mein Handy. Schreibe eine unheimlich wichtige SMS. Spiele unheimlich wichtige Spiele. Ich klammere mich fest an diesem Gegenstand. Er ist mein sicherer Anker, der mich in eurer Welt nicht untergehen lässt.
Ihr unterhaltet euch.
Ihr lacht.
Macht Späße.
Ich sollte meinen Platz räumen. Jemand anderes gehört dorthin.
Jemand, der sich mit euch unterhält.
Der mit euch lacht.
Späße macht.
Das würdet ihr nicht sagen. Wahrscheinlich denkt ihr das noch nicht mal.
Der einzige, der mich ausgrenzt, bin ich selbst.
Ich blicke mich im Zug um.
Dahinten ist noch ein Vierer mit Leuten aus unserem Kurs. Jetzt sehne ich mich in diesen, doch würde ich dort sitzen, würde ich mich genauso fremd fühlen.
Eine Zweier-Reihe könnte ich auch für mich alleine beanspruchen. Da könnte ich nicht in den Gesprächen, dem Leben untergehen. Auch würde ich mich nicht einsamer fühlen als mit euch neben mir. Trotzdem wäre es falsch, mich aus der Gruppe zu ziehen.
Also bleibe ich in eurem Vierer, lausche euren Gesprächen und Späßen und tue so, als wäre ich mit meinem Handy beschäftigt.
Ich blicke aus dem Fenster, beobachte, wie die dicken Regentropfen daran runterlaufen.
Endlos fallen.
Endlos frei sein.
Und dann der harte Aufprall, die Vereinigung mit anderen Tropfen, die den gleichen Weg hinter sich haben.
Vielleicht werde ich meinen Platz dort draußen finden.
"Es gibt einen Platz, den du füllen musst, den niemand sonst füllen kann, und es gibt etwas für dich zu tun, das niemand sonst tun kann."
[Platon]
Dienstag, 21. August 2012
Das Oink-Wau-Tier.
"Wau wau", der Schweinehund bellt in mir.
"Oink oink", der Schweinehund qiuetscht in mir.
"Geh, wau, nicht, oink!"
Nein nein, ich gehe nicht. Keine Angst. Faul aufm Bett liegen macht mir sehr viel Spaß! Das ist viel besser als Sport! Warum sollte ich losgehen?!
"Oink, sehr gut!"
Klar, dir gehorche ich doch immer!
Hey, Moment! Habe ich denn nicht auch einen eigenen Willen?
Ja, doch, der müsste doch irgendwo sein... Aber wo nur? Hat sich wohl in der hintersten Ecke meines Körpers verkrochen. Braucht man ja auch so selten. Gibt ja genug andere, dir mir sagen, was ich wollen will. Die Medien. Meine Mitmenschen. Der Schweinehund ("Ja, ich, wau!"). Ist ja auch alles viel angenehmer.
Jetzt ist der Wille vielleicht abgehauen. Kann das sein? Nochmal alles durchsuchen. Obwohl ... das ist ja auch so viel Arbeit!
"Ja, oink. Das ist zu viel Arbeit, wau! Lass, oink, das mal lieber, wau!"
Oh stimmt, du hast recht. Schön, dass du das auch so siehst. Mein Wille würde es auch nicht wollen, dass ich mich mit so unnötigen Aufgaben abgebe.
Ein Glück habe ich meinen Schweinehund!
Aber wenn doch ... ganz vielleicht. Nur noch hier hinter dieser Gehirnzelle nachschauen.
Oh, hups! Da ist der Wille ja!
Wo kommt der denn jetzt her?
"Der bescheuerte Schweinehund hat mich eingesperrt! Besieg den doch mal! Das gibt's doch gar nicht, so stark ist der doch auch nicht!"
Oh... Tut mir Leid, tut mir Leid. Was ... ähm ... will ich denn jetzt?
"Sport."
"Wau, drinnen bleiben, oink!"
"Raus!"
"Oink, Bett!"
"Bewegung!"
"Schlafen, wau!"
Mein. Kopf. Platzt.
Sie streiten sich. Mein Wille und mein Schweinehund. Wer ist stärker?
Ausreden über Ausreden.
Mein. Kopf. Platzt.
Ich muss raus.
Aber will ich denn auch raus?
Egal, was ich will.
Egal, was ich nicht will.
Ich. Bewege. Mich.
Wer hat jetzt gewonnen?
Das Oink-Wau-Tier?
Mein Wille?
Oder ich?
In mir ist so viel.
"Oink oink", der Schweinehund qiuetscht in mir.
"Geh, wau, nicht, oink!"
Nein nein, ich gehe nicht. Keine Angst. Faul aufm Bett liegen macht mir sehr viel Spaß! Das ist viel besser als Sport! Warum sollte ich losgehen?!
"Oink, sehr gut!"
Klar, dir gehorche ich doch immer!
Hey, Moment! Habe ich denn nicht auch einen eigenen Willen?
Ja, doch, der müsste doch irgendwo sein... Aber wo nur? Hat sich wohl in der hintersten Ecke meines Körpers verkrochen. Braucht man ja auch so selten. Gibt ja genug andere, dir mir sagen, was ich wollen will. Die Medien. Meine Mitmenschen. Der Schweinehund ("Ja, ich, wau!"). Ist ja auch alles viel angenehmer.
Jetzt ist der Wille vielleicht abgehauen. Kann das sein? Nochmal alles durchsuchen. Obwohl ... das ist ja auch so viel Arbeit!
"Ja, oink. Das ist zu viel Arbeit, wau! Lass, oink, das mal lieber, wau!"
Oh stimmt, du hast recht. Schön, dass du das auch so siehst. Mein Wille würde es auch nicht wollen, dass ich mich mit so unnötigen Aufgaben abgebe.
Ein Glück habe ich meinen Schweinehund!
Aber wenn doch ... ganz vielleicht. Nur noch hier hinter dieser Gehirnzelle nachschauen.
Oh, hups! Da ist der Wille ja!
Wo kommt der denn jetzt her?
"Der bescheuerte Schweinehund hat mich eingesperrt! Besieg den doch mal! Das gibt's doch gar nicht, so stark ist der doch auch nicht!"
Oh... Tut mir Leid, tut mir Leid. Was ... ähm ... will ich denn jetzt?
"Sport."
"Wau, drinnen bleiben, oink!"
"Raus!"
"Oink, Bett!"
"Bewegung!"
"Schlafen, wau!"
Mein. Kopf. Platzt.
Sie streiten sich. Mein Wille und mein Schweinehund. Wer ist stärker?
Ausreden über Ausreden.
Mein. Kopf. Platzt.
Ich muss raus.
Aber will ich denn auch raus?
Egal, was ich will.
Egal, was ich nicht will.
Ich. Bewege. Mich.
Wer hat jetzt gewonnen?
Das Oink-Wau-Tier?
Mein Wille?
Oder ich?
In mir ist so viel.
Montag, 13. August 2012
Alles abhaken.
Einen To-Do-Punkt abhaken und dann plötzlich nichts mehr zu tun zu haben. Nichts. Keine in den Hintergrund des Gewissens gedrängte Aufgabe, die schon seit Wochen aufgeschoben wird. Auch nichts, was man immer schon mal machen wollte, aber doch nie dazu gekommen ist. Alles ist erledigt.
Man kann sich hinlegen und sagen: "Ich habe alles geschafft". Ausnahmslos.
Das wünsche ich mir.
Aber geht das überhaupt?
Aus so vielen erledigten Aufgaben ergeben sich automatisch neue. Hausaufgaben gibt es auch fast jeden Tag. Saubermachen kann man immer. Lässt es sich ohne langfristige Ziele überhaupt leben?
Ich kenne die Antworten nicht. Denn ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal reinen Gewissens sagen konnte: "Ja, ich habe alles geschafft."
Immer ist etwas. Immer will jemand was. Immer will ich was.
Und das muss ja auch nicht schlecht sein:
Eine To-Do-Liste zu haben (ob auf Papier oder im Kopf) bedeutet, Ziele zu haben. Noch etwas, was es zu erreichen gibt. Ein Leben, das es zu (er)leben gibt.
Immer noch Dinge, die man abhaken kann, um dann zu sagen: "Ja, ich habe was geschafft." Was. Aber nicht alles. Nie alles. "Alles" gibt es gar nicht.
Es ist nichts Schlechtes, offene Erledigungen zu haben. Aber es wird zu etwas Schlechtem, wenn die Gedanken um nichts anderes kreisen. Wenn man sich über keinen Schritt freuen kann, weil man schon weiß, was als nächstes sein muss.
Wenn man im Kopf dauernd die vielen unerledigten Punkte sieht. Alles muss noch getan werden. Alles wird erwartet.
Es geht nur um Haken, Haken, Haken.
Alles wird in Listen gemessen.
Keine Gefühle.
Nur machen!
Richtig oder falsch.
Fertig oder nicht.
Ich bin fertig. Das ist falsch.
Machen, machen, machen!
Ein Ende ist nicht eingeplant.
Was, wenn ich nicht mehr kann?
Man kann sich hinlegen und sagen: "Ich habe alles geschafft". Ausnahmslos.
Das wünsche ich mir.
Aber geht das überhaupt?
Aus so vielen erledigten Aufgaben ergeben sich automatisch neue. Hausaufgaben gibt es auch fast jeden Tag. Saubermachen kann man immer. Lässt es sich ohne langfristige Ziele überhaupt leben?
Ich kenne die Antworten nicht. Denn ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal reinen Gewissens sagen konnte: "Ja, ich habe alles geschafft."
Immer ist etwas. Immer will jemand was. Immer will ich was.
Und das muss ja auch nicht schlecht sein:
Eine To-Do-Liste zu haben (ob auf Papier oder im Kopf) bedeutet, Ziele zu haben. Noch etwas, was es zu erreichen gibt. Ein Leben, das es zu (er)leben gibt.
Immer noch Dinge, die man abhaken kann, um dann zu sagen: "Ja, ich habe was geschafft." Was. Aber nicht alles. Nie alles. "Alles" gibt es gar nicht.
Es ist nichts Schlechtes, offene Erledigungen zu haben. Aber es wird zu etwas Schlechtem, wenn die Gedanken um nichts anderes kreisen. Wenn man sich über keinen Schritt freuen kann, weil man schon weiß, was als nächstes sein muss.
Wenn man im Kopf dauernd die vielen unerledigten Punkte sieht. Alles muss noch getan werden. Alles wird erwartet.
Es geht nur um Haken, Haken, Haken.
Alles wird in Listen gemessen.
Keine Gefühle.
Nur machen!
Richtig oder falsch.
Fertig oder nicht.
Ich bin fertig. Das ist falsch.
Machen, machen, machen!
Ein Ende ist nicht eingeplant.
Was, wenn ich nicht mehr kann?
Sonntag, 12. August 2012
Das Geheimnis der Namen.
Dein Name sagt etwas über dich aus. Denkst du dir. Dabei gibt nicht der Name dir etwas, sondern du dem Namen.
Du füllst das Wort mit Leben. Du passt den Namen an deinen Charakter an. Du baust dir etwas auf.
Dein Name ist nicht so einzigartig, wie du es bist.
Die Anna aus dem Nachbardorf ist ganz anders als du.
Der Tim aus der Parallelklasse ist nicht zu vergleichen mit dem Jungen, den du in dir siehst.
Und doch ist dein Name so etwas wie die Überschrift zu dir. Du hast dich daran gewöhnt. Und er gehört dir allein.
Könntest du ihn ändern?
Beginnt mit einem neuen Namen ein neues Leben?
Können sich andere daran gewöhnen?
Fühlst du dich angesprochen?
Nein... Es wird immer komisch bleiben.
Es wird immer etwas Falsches an sich haben.
Ein neuer Name wird nie wieder so selbstverständlich über die Lippen kommen wie der, den du seit der Geburt getragen hast.
Probier es aus.
Und wenn du es mit Gegenständen machst.
Ein Tisch ist kein Tisch mehr. Er ist ein Bett.
Ein Schreibbett.
Ein Essbett.
Das Bett decken.
Du schreibst auf einem Bett.
Du sitzt an einem Bett.
Dein Schulbett ist schon ganz bekritzelt. Auch wenn die Lehrer immer mahnen: "Nicht auf die Betten schreiben!" Denn die Betten sind Schuleigentum!
Du kannst es schaffen.
Aber es wird immer falsch klingen. Du wirst immer wissen, dass es falsch ist.
Es ist nur ein Wort. Es ist nicht der wahre Name.
Der, der in einem Wort so viel aussagen kann. Über dich. Über mich. Über die Welt.
Du füllst das Wort mit Leben. Du passt den Namen an deinen Charakter an. Du baust dir etwas auf.
Dein Name ist nicht so einzigartig, wie du es bist.
Die Anna aus dem Nachbardorf ist ganz anders als du.
Der Tim aus der Parallelklasse ist nicht zu vergleichen mit dem Jungen, den du in dir siehst.
Und doch ist dein Name so etwas wie die Überschrift zu dir. Du hast dich daran gewöhnt. Und er gehört dir allein.
Könntest du ihn ändern?
Beginnt mit einem neuen Namen ein neues Leben?
Können sich andere daran gewöhnen?
Fühlst du dich angesprochen?
Nein... Es wird immer komisch bleiben.
Es wird immer etwas Falsches an sich haben.
Ein neuer Name wird nie wieder so selbstverständlich über die Lippen kommen wie der, den du seit der Geburt getragen hast.
Probier es aus.
Und wenn du es mit Gegenständen machst.
Ein Tisch ist kein Tisch mehr. Er ist ein Bett.
Ein Schreibbett.
Ein Essbett.
Das Bett decken.
Du schreibst auf einem Bett.
Du sitzt an einem Bett.
Dein Schulbett ist schon ganz bekritzelt. Auch wenn die Lehrer immer mahnen: "Nicht auf die Betten schreiben!" Denn die Betten sind Schuleigentum!
Du kannst es schaffen.
Aber es wird immer falsch klingen. Du wirst immer wissen, dass es falsch ist.
Es ist nur ein Wort. Es ist nicht der wahre Name.
Der, der in einem Wort so viel aussagen kann. Über dich. Über mich. Über die Welt.
Donnerstag, 2. August 2012
Das Gesicht des Todes.
Wie sieht es aus, wenn Menschen sterben?
Ich meine nicht den letzten Atemzug, das letzte Keuchen, bevor sich der Brustkorb nie wieder hebt und senkt und kein Blut mehr durch die Adern fließt. Was ich meine, ist ein innerlicher Tod. Wenn der Körper nur noch eine Hülle ist, die nichts als Leere beherbergt. Wenn alle Gefühle dem endlosen Nichts weichen, die Farben schwinden und Bewegungen nur noch stumpfe Mechanik sind.
Tot. Und doch mit Pulsschlag.
Viele lassen sich leicht täuschen. Sie gehen davon aus, dass Menschen, die sich bewegen, auch leben. Wer mit ihnen spricht, ist nicht tot.
Und doch kann es sein, dass in genau diesem Moment leben mit purer Existenz verwechselt wird.
Nur wer achtsam ist, seine Blicke länger auf einer Person lässt und sich auch von Andersartigem nicht abschrecken lässt, kann solch einen Tod beobachten.
Diese Person kann die Kälte fühlen, die sich in einem anderen ausbreitet und ihn zu Boden wirft. Innerlich.
Die Augen werden leerer, der Blick ist quasi nach innen gelenkt. Dahin, wo der Kampf tobt. Wo sich der Tod unaufhaltsam ausbreitet.
Bewegungen werden langsamer.
Berührungen und Kontakt vermieden. Denn andere Menschen kosten so viel Kraft. Reden kostet Kraft. Lachen ist zu einer unmöglichen Aufgabe geworden.
Die Gesichtszüge werden ausdruckslos.
Der Körper kann andere wärmen, aber bei einem Blick in die Augen des Sterbenden beginnt man, zu frieren.
Und selbst wenn man den voranschreitenden Tod erkennt? Wie kann man helfen? Wie kann man eine Person retten, von der man weiß, sie liegt im Sterben? Doch das Sterben ist nicht sichtbar.
Niemand glaubt einem. Vielleicht nicht einmal derjenige selbst.
Der Tod nimmt die Person neben mir. Er lacht mich aus. Er weiß, ich sehe ihn. Und er weiß, ich kann ihn trotzdem nicht aufhalten.
Versagen. Unterlassene Hilfeleistung. Darauf steht Strafe nach dem Gesetz.
Aber man kann nicht bestrafen, was keiner sehen will.
Ich meine nicht den letzten Atemzug, das letzte Keuchen, bevor sich der Brustkorb nie wieder hebt und senkt und kein Blut mehr durch die Adern fließt. Was ich meine, ist ein innerlicher Tod. Wenn der Körper nur noch eine Hülle ist, die nichts als Leere beherbergt. Wenn alle Gefühle dem endlosen Nichts weichen, die Farben schwinden und Bewegungen nur noch stumpfe Mechanik sind.
Tot. Und doch mit Pulsschlag.
Viele lassen sich leicht täuschen. Sie gehen davon aus, dass Menschen, die sich bewegen, auch leben. Wer mit ihnen spricht, ist nicht tot.
Und doch kann es sein, dass in genau diesem Moment leben mit purer Existenz verwechselt wird.
Nur wer achtsam ist, seine Blicke länger auf einer Person lässt und sich auch von Andersartigem nicht abschrecken lässt, kann solch einen Tod beobachten.
Diese Person kann die Kälte fühlen, die sich in einem anderen ausbreitet und ihn zu Boden wirft. Innerlich.
Die Augen werden leerer, der Blick ist quasi nach innen gelenkt. Dahin, wo der Kampf tobt. Wo sich der Tod unaufhaltsam ausbreitet.
Bewegungen werden langsamer.
Berührungen und Kontakt vermieden. Denn andere Menschen kosten so viel Kraft. Reden kostet Kraft. Lachen ist zu einer unmöglichen Aufgabe geworden.
Die Gesichtszüge werden ausdruckslos.
Der Körper kann andere wärmen, aber bei einem Blick in die Augen des Sterbenden beginnt man, zu frieren.
Und selbst wenn man den voranschreitenden Tod erkennt? Wie kann man helfen? Wie kann man eine Person retten, von der man weiß, sie liegt im Sterben? Doch das Sterben ist nicht sichtbar.
Niemand glaubt einem. Vielleicht nicht einmal derjenige selbst.
Der Tod nimmt die Person neben mir. Er lacht mich aus. Er weiß, ich sehe ihn. Und er weiß, ich kann ihn trotzdem nicht aufhalten.
Versagen. Unterlassene Hilfeleistung. Darauf steht Strafe nach dem Gesetz.
Aber man kann nicht bestrafen, was keiner sehen will.
Mittwoch, 1. August 2012
Krieg. Ohne Ende.
Am Fenster fliegen die Bäume, die Menschen, das Leben vorbei. Stationen werden durchgesagt.
"Bitte rechts aussteigen!"
"Achtung, der Zug fährt ab!"
"Die Türen schließen."
Die nächste muss ich raus.
Ich erhebe mich von meinem Fensterplatz, gehe die paar Schritte zur Tür, drücke auf den Knopf und trete hinaus.
Aber nur in meinen Gedanken. So stelle ich mir den Ablauf vor. So sollte es sein. So einfach.
In der Realität kann ich mich nicht bewegen. Ich sitze. Gewichte hängen an meinen Armen, an meinen Beinen, stecken in meinen Schuhen. Jede Bewegung fällt so schwer.
Ich benötige meine gesamte Willenskraft, mich selbst dazu zu bewegen, aufzustehen. Wie geht es nochmal? Wie macht man das?
Ich muss mich an einer Stange festhalten, mich hochzuziehen, mich auf meine eigenen Beine zerren. Wie ein alter Mann brauche ich all meine Konzentration dafür, meine Körperteile davon zu überzeugen, nicht nachzugeben und mir zu gehorchen.
Zur Tür, nur ein kurzer Weg. Ein Fuß vor den anderen. Es ist so einfach. Es sollte so einfach sein.
Jeder Schritt fordert unglaubliche Kräfte. Der Zug hält, die Türen öffnen sich, nicht so langsam, ich muss raus!
Rechter Fuß.
Linker Fuß.
Rechter Fuß.
Grooooooßer Schritt.
Und ich stehe am Bahnsteig. Ich schwitze am ganzen Körper.
Ich kann nicht mehr stehen, brauche eine Bank.
Wo ist die nächste?
Zu weit. Das traue ich mir nicht zu. Lieber einfach stehen bleiben. Ein stiller Appell an meine Beine, bloß nicht nachzugeben. Einfach das Gewicht halten.
3 Minuten, dann kommt der Zug, in den ich einsteigen muss. Am Nachbargleis. 5 Schritte.
Stehen bleiben.
Noch 2 Minuten.
Ich kann nicht mehr atmen, bekomme keine Luft.
Konzentration!
Einatmen.
Ausatmen.
Noch eine Minute.
Nicht umfallen.
Luft rein.
Luft raus.
Der Zug kommt.
Ich sollte ein wenig näher ans Gleis treten.
Er hält.
5 Schritte noch.
Die Türen öffnen sich.
Meine Beine bewegen sich nicht.
Ein Fuß vor den anderen.
Der Zug ist voll. Es ist heiß. Ich kann mich nicht hinsetzen. Stattdessen versuche ich mich gegen eine Scheibe zu lehnen. Ich kralle mich an zwei Stangen fest. Um die Balance zu halten. Und um die Beine zu entlasten, die kurz davor sind, einfach zusammenzuknicken.
Es ist bloß eine Station, der Zug wird schon langsamer.
Gut, dass ich so nah am Ausgang stehe.
Nur ein großer Schritt und ...
Ich stehe wieder am Bahnsteig.
Menschen laufen an mir vorbei, eilen zu den Ausgängen. Sie wollen weiter. Vielleicht nach Hause. Ich will auch weiter.
Also wieder ein Fuß vor den anderen setzen. Gehen.
Links.
Rechts.
Oh, atmen nicht vergessen!
Einatmen. Links.
Ausatmen. Rechts.
So viel auf einmal. Mein Kopf droht zu platzen. Er scheint nicht in der Lage, zwei Sachen gleichzeitig zu koordinieren.
Die Treppe scheint wie ein unüberwindbares Hindernis.
Ich blicke an ihr hinauf und frage mich, ob ich es wohl je bis ganz nach oben schaffen werde.
Ich muss!
Also wieder volle Konzentration auf die Beine.
Auf einer Stufe steht mit Graffiti "Nice smile" geschrieben. Ich liebe solche kleinen Botschaften. Ich würde sofort lächeln. Es würde mir gefallen. Ich würde Pläne schmieden, wie auch ich solche Sätze an öffentliche Plätze schreiben werde.
Aber nicht heute.
Heute rühren sich meine Mundwinkel nicht. Es wäre zu anstrengend.
Atmen und Beine.
Atmen und Beine.
Weiter.
Weiter.
Weiter.
Und ich muss noch weiter!
Die Straße entlang, ein Fuß vor den anderen setzen.
Meine Arme hängen nutzlos an mir herab. Sie sind nur zusätzliche Gewichte, die meinen Körper beschweren. Ich würde sie gerne abschneiden. Vielleicht könnte ich mich dann schneller bewegen. Vielleicht wäre ich dann eleganter. Vielleicht könnte ich laufen.
Ich konzentriere mich weiter auf meine Füße.
Bloß nicht stehen bleiben. Einfach normal aussehen. Keiner soll ahnen, dass in mir ein Kampf tobt.
Ich vs. Ich. Runde 4297.
Wer gewinnt, ist nicht klar.
Ich versuche, meine Schritte zu zählen.
1
2
3
4
5
Weiter komme ich nicht, länger kann ich mich nicht darauf konzentrieren. Die Gedanken schwimmen in meinem Kopf wie vergessenes Gemüse in der Fleischsuppe. Es wird immer matschiger. Immer schwerer zu greifen.
Die Tür.
Öffnen.
Treppe. Hoch.
Nächste Tür.
Öffnen.
Rein.
Auf mein Bett fallen lassen.
Nicht mehr bewegen.
Nicht mehr atmen.
Liegen.
Liegen.
Liegen.
Ich bin angekommen.
Habe ich jetzt gewonnen
Oder verloren?
Abonnieren
Posts (Atom)