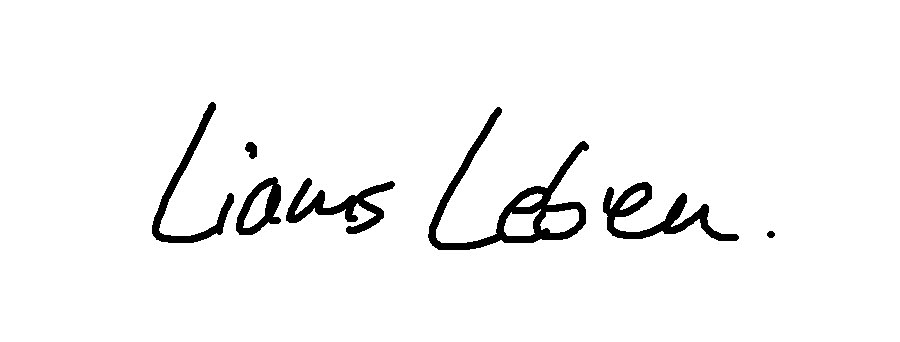"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen."
[Goethe]
Was aber, wenn die Steine so groß, so schwer sind, dass ich sie nicht heben kann? Wenn mit jedem Brocken, den ich entferne, eine neue Lawine auf mich herabstürzt?
Ich komme nicht weiter, überall ist mir mein Weg versperrt. Ich balanciere über die Geröllbrocken, sammle kleinere Kiesel auf und schmeiße sie beiseite, rolle die großen Felsen an den Straßenrand.
Manchmal denke ich mir auch: "Das reicht!" Dann nehme ich die Trümmer und staple sie zu Türmen, errichte mir Burgen, in denen ich mich eine Zeit lang verkriechen kann, Leben genießen kann. Ich konstruiere Denkmäler am Wegesrand, die für immer an meinen Kampf erinnern werden.
Aber dann muss ich weiter, ich muss weiter und die neue Lawine ergießt sich schon über meine Route. Ich habe keine Kraft mehr, bin von der letzten Anstrengung noch ganz schwach. Energielos schiebe ich ein paar Brocken zur Seite, dann muss ich mich setzen, muss Rast einlegen, ich kann nicht mehr. Also bleibe ich auf diesem Felstrümmer, verweile hier, unterbreche meine Reise. Vor mir sind nur Steine, nur Steine soweit das Auge reicht.
Über ein freies Wegesstück renne ich. Ich laufe, so schnell ich kann, laufe den fallenden Steinen davon. Doch es ist ausweglos, es ist nicht machbar, keine Chance. Sie zwingen mich in die Knie, ich stolpere über die Unebenheiten der Erde, schlage auf dem Grund auf, die Lawine von oben trifft mich und verschüttet mich unter sich. Ich bin am Boden, lebendig begraben, tonnenschweres Gewicht auf mir.
So viele Steine, ich könnte Luftschlösser aus ihnen errichten. Ich könnte Burgen bauen und Statuen erschaffen.
Was aber, wenn ich gar nichts bauen möchte, sondern einfach meinen Weg beschreiten, so geradeaus wie möglich?
Samstag, 31. August 2013
Samstag, 24. August 2013
Ein gelber Schmetterling.
Unter mir der graue Asphalt. Ich gehe durch die Straßen. Schritt für Schritt. Ich weiß nicht, wohin ich will. Ich weiß nicht, warum ich gehe. Ich wollte einfach nicht mehr drinnen sitzen müssen.
Mein Blick ist auf den Boden gerichtet. Die Platten des Gehwegs liegen unter mir. Aneinandergereiht. Stein an Stein. Grau und grau an grau.
Es ist, als würde alles um mich herum im Nebel versinken. Ich realisiere nichts. Ich denke nichts. In mir ist nichts.
Auf einmal nehme ich eine schnelle Bewegung neben meinem Kopf wahr. Ein Schmetterling, der mir ins Gesicht fliegt, Zentimeter an meiner Wange vorbei. Im Bruchteil einer Sekunde sehe ich ihn. Er ist hellgelb, bewegt seine Flügel auf und ab. Und er ist klein.
Für dieses zierliche Wesen habe ich meinen Blick gehoben. Und er bleibt oben. Weil ich jetzt plötzlich lächeln muss. Weil ich auf einmal das Leben um mich herum wahrnehme.
Ich sehe die Büsche am Wegesrand, höre das Kinderlachen aus den Gärten und rieche den aufgebauten Grill der Nachbarn.
Ich gehe weiter durch die Straßen, biege ab, wechsle die Seiten. Ich weiß immer noch nicht, wohin ich gehe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ankommen kann.
Sonntag, 18. August 2013
Sturmflut.
Ich lache.
Aber das Lachen erreicht meine Augen nicht. Erreicht mein Herz nicht. In mir bleibt es kalt. Und ich friere.
Die Härchen an meinen Armen stellen sich auf. Gänsehaut. Sie wollen eine Fellschicht bilden, die mich schützt. Vor der Kälte, vor dem eisigen Wind.
Aber der weht nicht draußen. Es stürmt in mir. Alles schwankt in mir. Ich schwanke. Das Unwetter breitet sich weiter in meinem Körper aus. Nebelschwaden ziehen in meinen Kopf, hüllen alles in trostloses Grau. Ich kann nicht mehr denken, kann keinen Gedanken mehr fassen. Ich fühle mich so schwer. Schwerfällig.
Und neben mir sitzen meine Freunde und sie lachen. Ich lache mit, ich freue mich mit. Ich höre zu und ich rede, aber ich weiß nicht, was ich sage. Ich weiß nicht, was sie sagen.
"Voll schön, dass es noch so warm ist!"
Ja. In mir stürmt es und es ist kalt.
Der Meeresspiegel in mir steigt. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Alles wird von den tosenden Fluten verschluckt. Mein Leben, meine Gefühle. Alles geht unter, alles versinkt. Hat jemand einen Rettungsring? Kann mir jemand ein Boot schicken?
SOS, ich bin allein auf offenem Meer.
SOS, kein Land in Sicht.
SOS, ich glaub, ich kann nicht schwimmen. Ich glaub, ich weiß nicht mehr, wie das geht.
Ich würde ja schreien, aber da ist nur Wasser. Ich schlucke Wasser, das schmeckt so salzig. Mein Mund ist voll, ich bin unter Wasser, niemand kann mich hören, wenn ich schrei.
Ich muss husten.
"Haha, alles gut?!"
Ja, ja. Hab mich nur verschluckt. Am Bier, am Meer in mir. Hab mich verschluckt an meiner Welt.
Freitag, 9. August 2013
Draußen ist es hell.
"I know you wanna stay in bed, but it's light outside! It's light outside!"
Mein Wecker reißt mich aus meinen Träumen. Ich drehe mich ein paarmal hin und her, schalte ihn aus und bleibe still im Bett liegen.
Es ist früh, ich bin müde, ich habe keine Lust! Also schließe ich meine Augen einfach wieder. Und reiße sie Sekunden später wieder auf, um auf die Uhr zu schauen.
Ich kämpfe mit mir selbst, kämpfe gegen mich. Gegen den Impuls, liegenzubleiben, weiterzuschlafen, an nichts mehr zu denken. Ich wickle mich in meine Decke, gehe in Gedanken den kommenden Schultag durch und werde noch unmotivierter, meine Beine heute aus dem Bett zu schwingen. Der Unterricht wird anstrengend, die Lehrer unorganisiert, das Gelernte unnötig sein. Ein wenig mehr Schlaf würde ganz bestimmt nicht schaden.
Mit offenen Augen gehe ich den Gedanken weiter nach, bis mein Blick auf die geschlossenen Gardinen fällt. Durch den dünnen Stoff scheint das Licht von außen zu mir herein. Ich weiß, dass die Sonne scheint, ohne es zu sehen. Jetzt schon, um sieben Uhr morgens. Ich fühle die Wärme und spüre die Helligkeit.
Ich denke kurz darüber nach, dass die Sonne auch in 3 Stunden noch scheinen wird, setze mich dann doch aufrecht hin und stelle meine Beine auf den Teppichboden.
Beim Öffnen der Vorhänge bin ich froh, heute aufgestanden zu sein.
Mein Wecker reißt mich aus meinen Träumen. Ich drehe mich ein paarmal hin und her, schalte ihn aus und bleibe still im Bett liegen.
Es ist früh, ich bin müde, ich habe keine Lust! Also schließe ich meine Augen einfach wieder. Und reiße sie Sekunden später wieder auf, um auf die Uhr zu schauen.
Ich kämpfe mit mir selbst, kämpfe gegen mich. Gegen den Impuls, liegenzubleiben, weiterzuschlafen, an nichts mehr zu denken. Ich wickle mich in meine Decke, gehe in Gedanken den kommenden Schultag durch und werde noch unmotivierter, meine Beine heute aus dem Bett zu schwingen. Der Unterricht wird anstrengend, die Lehrer unorganisiert, das Gelernte unnötig sein. Ein wenig mehr Schlaf würde ganz bestimmt nicht schaden.
Mit offenen Augen gehe ich den Gedanken weiter nach, bis mein Blick auf die geschlossenen Gardinen fällt. Durch den dünnen Stoff scheint das Licht von außen zu mir herein. Ich weiß, dass die Sonne scheint, ohne es zu sehen. Jetzt schon, um sieben Uhr morgens. Ich fühle die Wärme und spüre die Helligkeit.
Ich denke kurz darüber nach, dass die Sonne auch in 3 Stunden noch scheinen wird, setze mich dann doch aufrecht hin und stelle meine Beine auf den Teppichboden.
Beim Öffnen der Vorhänge bin ich froh, heute aufgestanden zu sein.
Mittwoch, 7. August 2013
Die Post.
Jeden Tag öffne ich den Briefkasten. Ich blicke in seinen schwarzen Schlund und sehe - nichts. Nur gähnende Leere, kein einzelner Brief, keine Karte, nicht mal Werbung. Die Post war noch nicht da. Oder ist heute einfach so vorübergezogen, hat unserem Haus keine Beachtung geschenkt. Nichts zuzustellen.
Oder könnte es etwa sein, dass die Postbotin ihren Beruf nicht ernstnimmt? Einen Fehler gemacht hat? Der Brief in ihrem Auto verlorengegangen ist, unter einen Sitz gerutscht, sich in einem Stapel anderer Sendungen versteckt? Womöglich ist er beim Nachbarn gelandet, aus Versehen.
Alles Mögliche spiele ich in Gedanken durch, alles Unmögliche auch. Aber es bleibt dabei: Keine Post an diesem Tag.
Ein anderer Tag oder ein paar Stunden später und wieder mein gewöhnlicher Blick in den schwarzen Kasten. Heute sehe ich was, heute ist da was, da ist ganz viel. Ich sehe - nicht für mich, nicht für mich, Werbung, keine Ahnung, Postkarte. Oh, wer war denn in Barcelona? Aha, nett, interessant. Aber ansonsten? Nichts!
Ich durchsuche den Stapel erneut. Nicht das, was ich suche. Nicht das, was ich erwarte. Schon wieder.
Ich vergewissere mich noch einmal, nichts im Briefkasten vergessen zu haben, lasse meinen Blick über den Boden schweifen, denn man weiß ja nie, wo kleine leichte Briefe so hinflattern.
Es bleibt dabei: Nicht meine Post an diesem Tag.
Dann werd ich wohl morgen wieder nachgucken.
Oder könnte es etwa sein, dass die Postbotin ihren Beruf nicht ernstnimmt? Einen Fehler gemacht hat? Der Brief in ihrem Auto verlorengegangen ist, unter einen Sitz gerutscht, sich in einem Stapel anderer Sendungen versteckt? Womöglich ist er beim Nachbarn gelandet, aus Versehen.
Alles Mögliche spiele ich in Gedanken durch, alles Unmögliche auch. Aber es bleibt dabei: Keine Post an diesem Tag.
Ein anderer Tag oder ein paar Stunden später und wieder mein gewöhnlicher Blick in den schwarzen Kasten. Heute sehe ich was, heute ist da was, da ist ganz viel. Ich sehe - nicht für mich, nicht für mich, Werbung, keine Ahnung, Postkarte. Oh, wer war denn in Barcelona? Aha, nett, interessant. Aber ansonsten? Nichts!
Ich durchsuche den Stapel erneut. Nicht das, was ich suche. Nicht das, was ich erwarte. Schon wieder.
Ich vergewissere mich noch einmal, nichts im Briefkasten vergessen zu haben, lasse meinen Blick über den Boden schweifen, denn man weiß ja nie, wo kleine leichte Briefe so hinflattern.
Es bleibt dabei: Nicht meine Post an diesem Tag.
Dann werd ich wohl morgen wieder nachgucken.
Sonntag, 4. August 2013
Fahrt auf dem Gedankenkarussell.
Ich sitze auf dem Sofa. Ich sitze nur da und starre vor mich hin. Ich denke an nichts. Ich mache nichts. Ich bin einfach da. Und bewege mich nicht.
Ich versuche, meine Welt anzuhalten. Sie soll einfrieren, ich will alles zum Erstarren bringen. Das wuselige Treiben der großen Stadt, die Menschen um mich herum. Und den aufgeregten Ameisenhaufen in mir, der meinen Bauch bewohnt. Es soll alles ruhig sein. Starr - für nur einen Moment.
Und doch geht es nicht. Mein Kopf fährt Achterbahn, auch wenn mein Körper ruht. Mein Magen findet keine Ruhe, ob ich sitze oder renne. Alles ist rasant. Um mich herum und in mir drin.
Aufgaben drängen sich mir auf, so viel "Du-musst-noch"s und so viel zu tun. Meine Gedanken wollen nicht ruhen, und mit ihnen kann ich es auch nicht.
Ich schalte Musik an. Will meine Gedanken auf die Melodien fokussieren, sie bändigen. Doch egal welches Lied ich höre, sie springen weiter hin und her, arbeiten weiter unentwegt. Nur wenige Sekunden bleibt ein Song, schnell stelle ich weiter und weiter und dann wieder der nächste und der nächste. Selten bleibe ich bis zum Refrain an einem hängen.
Zwischen Linkin Park und Billy Talent begegnet mir plötzlich Bosse, der ruhig auf mich einsingt. Nach seinem Motto probiere ich jetzt, mein Gedankenkarussell zu stoppen.
"Wenn ich meine Augen schließe, will ich kein Problem mehr."
Doch auch mit geschlossenen Augen rast es weiter in meinem Kopf, es rumort in meinem Bauch. Jetzt mischen sich auch noch Bilder dazu, die sich mir in der Dunkelheit aufdrängen.
Also drücke ich auf "weiter" und höre das nächste Lied.
Etwas Schnelles, etwas Lautes, ganz egal von wem. Es ist nicht der Text, der zählt. Aber der Rhythmus leitet meine Gedanken, fliegt so schnell umher wie sie es tun.
Das Karussell in meinem Kopf und der Ameisenhaufen in meinem Bauch fühlen sich von der temporeichen Melodie verstanden. Das ist was zählt, während ich mich aus meiner Starre löse, aufstehe und mich auf meinem Bett zusammenrolle. Die Nacht kann kommen - es ist laut in mir.
Ich versuche, meine Welt anzuhalten. Sie soll einfrieren, ich will alles zum Erstarren bringen. Das wuselige Treiben der großen Stadt, die Menschen um mich herum. Und den aufgeregten Ameisenhaufen in mir, der meinen Bauch bewohnt. Es soll alles ruhig sein. Starr - für nur einen Moment.
Und doch geht es nicht. Mein Kopf fährt Achterbahn, auch wenn mein Körper ruht. Mein Magen findet keine Ruhe, ob ich sitze oder renne. Alles ist rasant. Um mich herum und in mir drin.
Aufgaben drängen sich mir auf, so viel "Du-musst-noch"s und so viel zu tun. Meine Gedanken wollen nicht ruhen, und mit ihnen kann ich es auch nicht.
Ich schalte Musik an. Will meine Gedanken auf die Melodien fokussieren, sie bändigen. Doch egal welches Lied ich höre, sie springen weiter hin und her, arbeiten weiter unentwegt. Nur wenige Sekunden bleibt ein Song, schnell stelle ich weiter und weiter und dann wieder der nächste und der nächste. Selten bleibe ich bis zum Refrain an einem hängen.
Zwischen Linkin Park und Billy Talent begegnet mir plötzlich Bosse, der ruhig auf mich einsingt. Nach seinem Motto probiere ich jetzt, mein Gedankenkarussell zu stoppen.
"Wenn ich meine Augen schließe, will ich kein Problem mehr."
Doch auch mit geschlossenen Augen rast es weiter in meinem Kopf, es rumort in meinem Bauch. Jetzt mischen sich auch noch Bilder dazu, die sich mir in der Dunkelheit aufdrängen.
Also drücke ich auf "weiter" und höre das nächste Lied.
Etwas Schnelles, etwas Lautes, ganz egal von wem. Es ist nicht der Text, der zählt. Aber der Rhythmus leitet meine Gedanken, fliegt so schnell umher wie sie es tun.
Das Karussell in meinem Kopf und der Ameisenhaufen in meinem Bauch fühlen sich von der temporeichen Melodie verstanden. Das ist was zählt, während ich mich aus meiner Starre löse, aufstehe und mich auf meinem Bett zusammenrolle. Die Nacht kann kommen - es ist laut in mir.
Freitag, 2. August 2013
Liam.
"Liam!"
Der Ruf hallt in meinem Kopf wider. Ich höre den Klang meines Namens, wenn ich die Augen schließe. Wenn ich abends im Bett liege. Obwohl ich ganz alleine bin.
Immer wieder ertönt er in meinen Gedanken. Von verschiedenen Menschen ausgesprochen, in ganz verschiedenen Tonlagen und mit ganz unterschiedlichen Gefühlen. Alle möglichen Absichten stecken dahinter.
Ich höre "Liam!" als Aufforderung, "Liam?" als Anrede, "Liam,..." als Beginn einer Rede, einer Ansprache, einem Vortrag an mich.
Ich höre, wie ich gerufen werde. Wie ich um etwas gebeten, gefragt, angesprochen werde - von den Stimmen in meinem Kopf. Sie wollen etwas von mir. Sie wollen mit mir reden, wollen meine Aufmerksamkeit, wollen einen Teil von mir.
Und sie nutzen meinen Namen, meine vier Buchstaben, um mich zu gewinnen. Das Wort, das mich aufzucken lässt. Wodurch ich mich angesprochen fühle. Was immer etwas auslösen wird in mir.
Obwohl es nur eine Bezeichnung ist, ein Titel, eine Aufschrift, mein Etikett. Wahllos gewählt, einer unter tausend, und doch mein Charakter, meine Kennung, der eine für mich.
Mein Name bestimmt mich. Und ich bestimme ihn.
Ich lebe mit ihm. Durch ihn. Er ist ich. Ich bin Liam.
Der Ruf hallt in meinem Kopf wider. Ich höre den Klang meines Namens, wenn ich die Augen schließe. Wenn ich abends im Bett liege. Obwohl ich ganz alleine bin.
Immer wieder ertönt er in meinen Gedanken. Von verschiedenen Menschen ausgesprochen, in ganz verschiedenen Tonlagen und mit ganz unterschiedlichen Gefühlen. Alle möglichen Absichten stecken dahinter.
Ich höre "Liam!" als Aufforderung, "Liam?" als Anrede, "Liam,..." als Beginn einer Rede, einer Ansprache, einem Vortrag an mich.
Ich höre, wie ich gerufen werde. Wie ich um etwas gebeten, gefragt, angesprochen werde - von den Stimmen in meinem Kopf. Sie wollen etwas von mir. Sie wollen mit mir reden, wollen meine Aufmerksamkeit, wollen einen Teil von mir.
Und sie nutzen meinen Namen, meine vier Buchstaben, um mich zu gewinnen. Das Wort, das mich aufzucken lässt. Wodurch ich mich angesprochen fühle. Was immer etwas auslösen wird in mir.
Obwohl es nur eine Bezeichnung ist, ein Titel, eine Aufschrift, mein Etikett. Wahllos gewählt, einer unter tausend, und doch mein Charakter, meine Kennung, der eine für mich.
Mein Name bestimmt mich. Und ich bestimme ihn.
Ich lebe mit ihm. Durch ihn. Er ist ich. Ich bin Liam.
Abonnieren
Posts (Atom)