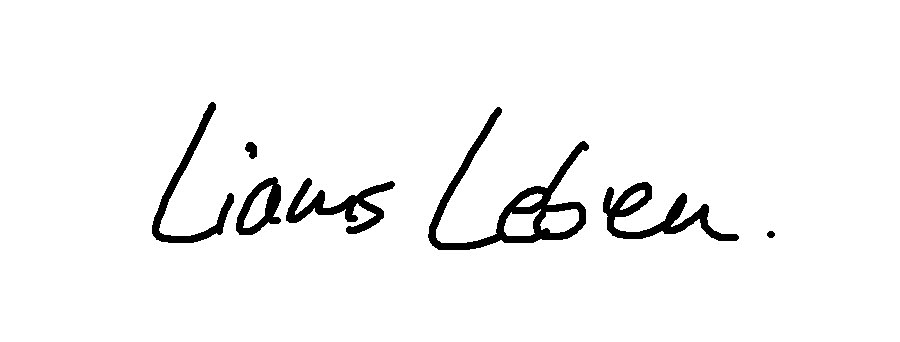Am Schreibtisch sitzen mit
Mathehausaufgaben und Tee, mit
Musik und Messer, an
Laptop und Handy.
Ich trinke einen Schluck.
Lasse mein Mathe-Heft zugeklappt.
Schaue auf mein Handy,
aber habe keine Kraft, zu antworten.
Ich blicke auf das Whatsapp-Symbol, auf
5 Nachrichten in 4 Chats, auf
eine neue SMS.
Und schalte mein Handy
Aus.
Ich will allein sein, nur mit mir.
Allein am Tisch sitzen.
Allein in meinem Kopf.
Allein mit mir.
Die Musik läuft und zeigt mir,
wie ich mich fühle, was ich denke,
was ich nicht sagen kann.
Bei traurigen Moll-Klängen merke ich,
wie einsam ich bin und
greife zur Klinge.
Sie ist da, sie bleibt da -
und ich kämpfe mit mir.
Drücke auf Pause.
Lege das Messer in den Schrank.
Beim nächsten Lied singe ich mit,
suche Ablenkung,
schalte mein Handy wieder ein und
antworte auf
5 Nachrichten in 4 Chats und
eine neue SMS.
Freitag, 28. Februar 2014
Mittwoch, 26. Februar 2014
Die Nacht ist wach.
Das Haus liegt dunkel um mich herum, es ist still. Vereinzelt knackt es hier und da, wenn der Wind von außen gegen die Wände drückt oder die Mauern ihr Eigenleben zur Schau stellen.
Es knarzt auch, wenn ich einen Fuß vor den anderen setze. Die hölzernen Stufen ächzen unter dem Gewicht meiner Füße. Unendlich laut, so kommt es mir vor, wenn sonst alles dunkel und still ist. Langsam taste ich mich Stufe für Stufe weiter. Den Atem anhaltend, wenn die Geräusche gegen meine Ohren drücken. Aber im oberen Stockwerk bleibt alles ruhig, keine Tür wird geöffnet, keine Lichter werden entflammt.
So stehe ich in Finsternis vor der Haustür und ziehe den Schlüssel sanft aus meiner Hosentasche, behutsam darauf bedacht, die einzelnen Metallstücke nicht gegeneinanderscheppern zu lassen. Millimeter für Millimeter schiebe ich meine Hand zur Tasche und von der Tasche zum Schloss. Ich schiebe den Schlüssel in den Zylinder, langsam, ohne zu zittern.
Metall ratscht an Metall, während ich drehe und drehe. Mein Kopf ist nach oben gerichtet und hält nach der kleinsten Bewegung Ausschau. Es ist keine zu erkennen. Auch dann nicht, als die schwere Haustür mit einem schnappenden Klicken aufspringt und die kalte Luft ins Haus weht. Ich schließe die Augen und genieße den Windhauch.
Dann bücke ich mich zum Boden und greife nach meinen bereitgestellten Schuhen, ich nehme sie in die Hand und trete auf Socken nach draußen. Der steinerne Boden dringt kalt und hart durch den Stoff auf meine Sohlen. Ich spüre es, draußen zu sein, während ich mit einer Hand noch den Türgriff umklammere. Der schwerste, der lauteste Teil folgt noch. Ich muss die Tür in seine Angeln zurückziehen. Sie wird zuknallen, egal wie liebevoll ich mit ihr umgehe. Der Rahmen wird erzittern, das Schloss geräuschvoll zuschnappen.
Ich verharre einige Sekunden regungslos vor dem Haus. Als sich kein Vorhang bewegt, kein Fenster erhellt und kein Geräusch zu mir dringt, setze ich mich auf die Stufen und ziehe meine Schuhe an.
Dann nehme ich die Beine in die Hand und laufe der Nacht entgegen. Ich atme die kühle Luft, spüre den harten Boden bei jedem Schritt und sehe nur dunkle und verlassene Häuser neben mir. Die Straßen sind leer, alle Rollos runtergelassen.
Die Stadt ist tot.
Die Nacht ist wach.
Es knarzt auch, wenn ich einen Fuß vor den anderen setze. Die hölzernen Stufen ächzen unter dem Gewicht meiner Füße. Unendlich laut, so kommt es mir vor, wenn sonst alles dunkel und still ist. Langsam taste ich mich Stufe für Stufe weiter. Den Atem anhaltend, wenn die Geräusche gegen meine Ohren drücken. Aber im oberen Stockwerk bleibt alles ruhig, keine Tür wird geöffnet, keine Lichter werden entflammt.
So stehe ich in Finsternis vor der Haustür und ziehe den Schlüssel sanft aus meiner Hosentasche, behutsam darauf bedacht, die einzelnen Metallstücke nicht gegeneinanderscheppern zu lassen. Millimeter für Millimeter schiebe ich meine Hand zur Tasche und von der Tasche zum Schloss. Ich schiebe den Schlüssel in den Zylinder, langsam, ohne zu zittern.
Metall ratscht an Metall, während ich drehe und drehe. Mein Kopf ist nach oben gerichtet und hält nach der kleinsten Bewegung Ausschau. Es ist keine zu erkennen. Auch dann nicht, als die schwere Haustür mit einem schnappenden Klicken aufspringt und die kalte Luft ins Haus weht. Ich schließe die Augen und genieße den Windhauch.
Dann bücke ich mich zum Boden und greife nach meinen bereitgestellten Schuhen, ich nehme sie in die Hand und trete auf Socken nach draußen. Der steinerne Boden dringt kalt und hart durch den Stoff auf meine Sohlen. Ich spüre es, draußen zu sein, während ich mit einer Hand noch den Türgriff umklammere. Der schwerste, der lauteste Teil folgt noch. Ich muss die Tür in seine Angeln zurückziehen. Sie wird zuknallen, egal wie liebevoll ich mit ihr umgehe. Der Rahmen wird erzittern, das Schloss geräuschvoll zuschnappen.
Ich verharre einige Sekunden regungslos vor dem Haus. Als sich kein Vorhang bewegt, kein Fenster erhellt und kein Geräusch zu mir dringt, setze ich mich auf die Stufen und ziehe meine Schuhe an.
Dann nehme ich die Beine in die Hand und laufe der Nacht entgegen. Ich atme die kühle Luft, spüre den harten Boden bei jedem Schritt und sehe nur dunkle und verlassene Häuser neben mir. Die Straßen sind leer, alle Rollos runtergelassen.
Die Stadt ist tot.
Die Nacht ist wach.
Freitag, 21. Februar 2014
Am ersten schönen Tag.
Auf einer Bank sitzend, beobachte ich, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume scheinen. Wie sie Muster auf die Wege werfen und Schatten tanzen lassen. Ich blicke den Passanten ins Gesicht und lächle sie an.
Zwei Mädchen auf der gegenüberliegenden Straßenseite, an der Bushaltestelle, ihre Köpfe zusammengesteckt, über ein Smartphone gebeugt, Schultaschen in ihren Händen. Sie lachen, sie flüstern, sie reden, wer weiß schon, worüber. Und dann plötzlich haben sie es eilig, laufen los, ihre Schritte hallen über die Straße, während sie auf den Schulhof einbiegen. Pause an der Bushalte gemacht.
Eine Gruppe Fünft-, Sechst-, Siebtklässler zieht lärmend an mir vorbei - so viele, dass ich schnell aufhöre zu zählen. Vereinzelt versuchen Lehrer für Ordnung, Reih und Glied in der bunten Truppe zu sorgen.
"Hallo!", grinst mich einer im Vorbeigehen an.
"Haaaallo!", grinse ich zurück.
"Wie geht's?"
Ich antworte nicht darauf. Wozu auch. Schätze, solange es geht, ist alles ok.
Während die letzten Nachzügler noch von den allerletzten Lehrern angetrieben werden, kommt ein Mann von der anderen Seite gerannt. Er beschleunigt seine Schritte immer mehr, bis er schließlich in einen Sprint gelangt. Zu einem haltenden Bus. Der fährt an, hält wieder, öffnet die Türen und nimmt den Läufer mit. Türen wieder zu, wieder losfahren, wegfahren. Ich blicke ihm hinterher, wie er sich an parkenden Autos und Radfahrern vorbeischiebt.
Auf dem Ziffernblatt der großen Uhr steht es drei Minuten vor voll und weil ich zwar gerne noch bleiben würde, mich aber langsam beeilen muss, stehe ich auf und lasse meinen Blick noch einmal schweifen. Das Krankenhaus liegt geschäftig hinter mir, Busse, Taxen und Krankenwagen fahren vor, der Hof ist voller Ärzte, Pflegerinnen und Patienten.
Ich blicke zwischen dem lebendigen Treiben und dem Gebäude hin und her und frage mich, wer hinter den Fenstern wohl gerade um sein Leben kämpft. Welche Ärzte in diesem Moment alles geben. Wessen Herz hier heute sterben wird. Nur wenige Meter vom ersten schönen Tag des Jahres getrennt.
Zwei Mädchen auf der gegenüberliegenden Straßenseite, an der Bushaltestelle, ihre Köpfe zusammengesteckt, über ein Smartphone gebeugt, Schultaschen in ihren Händen. Sie lachen, sie flüstern, sie reden, wer weiß schon, worüber. Und dann plötzlich haben sie es eilig, laufen los, ihre Schritte hallen über die Straße, während sie auf den Schulhof einbiegen. Pause an der Bushalte gemacht.
Eine Gruppe Fünft-, Sechst-, Siebtklässler zieht lärmend an mir vorbei - so viele, dass ich schnell aufhöre zu zählen. Vereinzelt versuchen Lehrer für Ordnung, Reih und Glied in der bunten Truppe zu sorgen.
"Hallo!", grinst mich einer im Vorbeigehen an.
"Haaaallo!", grinse ich zurück.
"Wie geht's?"
Ich antworte nicht darauf. Wozu auch. Schätze, solange es geht, ist alles ok.
Während die letzten Nachzügler noch von den allerletzten Lehrern angetrieben werden, kommt ein Mann von der anderen Seite gerannt. Er beschleunigt seine Schritte immer mehr, bis er schließlich in einen Sprint gelangt. Zu einem haltenden Bus. Der fährt an, hält wieder, öffnet die Türen und nimmt den Läufer mit. Türen wieder zu, wieder losfahren, wegfahren. Ich blicke ihm hinterher, wie er sich an parkenden Autos und Radfahrern vorbeischiebt.
Auf dem Ziffernblatt der großen Uhr steht es drei Minuten vor voll und weil ich zwar gerne noch bleiben würde, mich aber langsam beeilen muss, stehe ich auf und lasse meinen Blick noch einmal schweifen. Das Krankenhaus liegt geschäftig hinter mir, Busse, Taxen und Krankenwagen fahren vor, der Hof ist voller Ärzte, Pflegerinnen und Patienten.
Ich blicke zwischen dem lebendigen Treiben und dem Gebäude hin und her und frage mich, wer hinter den Fenstern wohl gerade um sein Leben kämpft. Welche Ärzte in diesem Moment alles geben. Wessen Herz hier heute sterben wird. Nur wenige Meter vom ersten schönen Tag des Jahres getrennt.
Donnerstag, 13. Februar 2014
Erinnerungen.
Der Wind, der mir ins Gesicht weht, während ich mit meinen kurzen Beinchen in die Pedale des Kettcars trete und trotz Geschwindigkeit am Limit noch von Fußgängern überholt werde. Das krakelige Haus mit Schornstein und rotem Dach, das ich auf das vor mir liegende Papier malen muss; ich traue mich nicht, zu husten, weil ich befürchte, sonst durch den Einschulungstest zu fallen. Meine Schultüte, die ich, auf einem weißen Teppich sitzend, ausschütte. Die blaue Wand meines Zimmers, das mein Vater und ich gerade gestrichen haben. Das weißte Gartentor, hinter dem ein Hund bellt, sobald ich vorbeigehe; ich beschleunige meine Schritte jedes Mal. Die Ohrfeige, weil ich die Mathe-Hausaufgaben nicht verstehen kann oder verstehen will. Die Bühne, auf der wir aufgereiht stehen und singen, der Blick ins Publikum, die plötzliche Übelkeit, die mich zwingt, abzutreten und mich vor der Kirche auf den steinernen Boden zu setzen. Das erste Mal Busfahren ohne Karte; die Augen des Busfahrers im Spiegel; ich fühle mich beobachtet. Die Nacht vor meinem neunten Geburtstag, in der ich nicht schlafen kann und versuche, Schäfchen zu zählen. Das hölzerne Geländer, über das ich klettere, dann plötzlich das bodenlose Nichts, der freie Fall, das Liegenbleiben am Boden, das Überprüfen, ob ich mich noch bewegen kann. Der Ball, der vor meine Füße rollt und von meinen Füßen ins Tor und dann im Netz zappelt und alles jubelt und das High Five danach; mein erstes Tor. Die geweiteten Augen des Fußgängers, als ich gegen ihn fahre. Der bunte Brief in meinem Briefkasten, als ich von der Schule nach Hause komme; ich verstecke ihn in meiner Tasche und werde mit niemandem darüber reden. Die rote Note auf meiner Mappe, die nichts als Enttäuschung hinterlässt, weil ich so lange daran gearbeitet habe. Die roten Gummistiefel, mit denen ich über die Weide laufe, und versuche, die Schafe einzufangen. Das rote Notenheft und das Klavier, auf dem ich spielen soll. Die roten Krücken und wie sie mir in die laus-besetze Hecke fallen. Die blaue Schaufel, mit der mein Bruder auf mich einschlägt. Die Steiff-Dinosaurier, die wir im ganzen Haus verteilen, um uns dann gegenseitig beim Suchen anzufeuern. Die Frage, ob ich nicht lieber über Nacht bleiben wolle. Der heiße Tee, den mir die Nachtschwester ans Klappbett bringt. Das grüne Hochbett, das mit Namen und Narben verziert ist. Der dicke Bauch meiner Mutter, um den meine Arme irgendwann nicht mehr herumpassen. Der winzige Fußabdruck auf dem blauen Papier, mit dem ich nichts anfangen kann, bis mein Bruder mir die dazugehörigen winzigen Füßchen entgegenstreckt. Die zwei kleinen Jungen im Bett neben mir, deren Mutter den ganzen Tag im Zimmer bleibt. Das kalte Geländer, an dem ich mich festklammere, als ich meine ersten Schritte nach tagelangem Liegen auf den PVC-Boden setze. Der kalte Rand der Toilettenschüssel. Das Lachen der anderen in der U-Bahn. Die große blaue Tasche, die ich jedes Wochenende mit meiner dreckigen Wäsche fülle und durch Bus und Bahn nach Hause schleppe. Der Friseur, der mich fragt, ob ich mir sicher bin. Das einsame Fleckchen Erde mit einem Dach aus Ästen darüber, unter das ich mich verkrieche, sobald es zur Pause klingelt. Zu dritt auf einen Stuhl gezwängt sitzen, um Computer zu spielen. Der Swimming-Pool auf dem Bauernhof; die frische Milch dazu. Rauschende Flüsse, die am Auto vorbeiziehen, in dem wir gemeinsam singen. Die kalten Steine des Carports, auf die ich mich fallen lasse, um nicht zur Schule zu müssen. Das Polizeiauto, das mir sofort in die Augen springt, als ich die Tür öffne, und die Frage, ob meine Mutter denn auch zu Hause ist. Die Angst, nicht wieder nach Hause zu finden.
Mittwoch, 5. Februar 2014
Die Welt ist schwarz-weiß.
Manchmal ist die Welt plötzlich schwarz-weiß. Die grellen Farben verblassen und verschwimmen, bis sie nur noch in Graustufen existieren.
Was zunächst wie eine Erleichterung wirkt, wird bald zu quälender Monotonie, Melancholie legt sich wie fallender Schnee über die Erde und bedeckt alles wie ein Tuch. Mit den schimmernden Farben der Neon-Lichter und den strahlenden Blautönen lächelnder Augen verschwindet auch das Leben aus der Welt.
Wie ein kaputter Fernseher, den ich versuche zu reparieren, rauscht und rauscht und rauscht das Bild auch nach dem dritten Schlag, der auf das Gehäuse trifft. Es wird alles nur noch schlimmer, denn plötzlich verstummen auch die Geräusche. Der schwarz-weiße Film wird zum Stummfilm.
Niemand lacht mehr und niemand schreit, niemand ruft mehr meinen Namen; keine Vögel zwitschern, keine Regentropfen prasseln mehr auf das Dach.
Wie unter einem Helm, der über meinen Kopf gezogen wurde, werde ich von der Welt abgeschottet. Kein Leben dringt durch das verstärkte Visier hindurch. Kein Freund, kein Feind kann den Käfig erreichen, in dem ich mich gefangen halte.
Die graue weite Welt erstreckt sich über schwarze Felder und weiße Wiesen bis zum endlosen Horizont. In jeder Richtung ist alles Leben bloß schwarz-weiß.
Nur Blut bleibt immer rot.
Was zunächst wie eine Erleichterung wirkt, wird bald zu quälender Monotonie, Melancholie legt sich wie fallender Schnee über die Erde und bedeckt alles wie ein Tuch. Mit den schimmernden Farben der Neon-Lichter und den strahlenden Blautönen lächelnder Augen verschwindet auch das Leben aus der Welt.
Wie ein kaputter Fernseher, den ich versuche zu reparieren, rauscht und rauscht und rauscht das Bild auch nach dem dritten Schlag, der auf das Gehäuse trifft. Es wird alles nur noch schlimmer, denn plötzlich verstummen auch die Geräusche. Der schwarz-weiße Film wird zum Stummfilm.
Niemand lacht mehr und niemand schreit, niemand ruft mehr meinen Namen; keine Vögel zwitschern, keine Regentropfen prasseln mehr auf das Dach.
Wie unter einem Helm, der über meinen Kopf gezogen wurde, werde ich von der Welt abgeschottet. Kein Leben dringt durch das verstärkte Visier hindurch. Kein Freund, kein Feind kann den Käfig erreichen, in dem ich mich gefangen halte.
Die graue weite Welt erstreckt sich über schwarze Felder und weiße Wiesen bis zum endlosen Horizont. In jeder Richtung ist alles Leben bloß schwarz-weiß.
Nur Blut bleibt immer rot.
Dienstag, 4. Februar 2014
Ein Haus aus Worten.
Schwarz auf weiß stehen die Worte, in Tinte auf Papier, verewigt auf dem weißen Blatt. Jeder Buchstabe lächelt mich an und nickt mir zu. Die Punkte auf den i's starren mich wie zwinkernde Augen an. Die runden Wölbungen der e's, der u's, der a's sind Münder zu grinsenden Grimassen verzogen.
So viele Augen schauen mich an. So viele Buchstaben wollen mir etwas sagen.
Wort für Wort leiten sie mich durch die Sprache. Wort für Wort formen sich Bilder in meinem Kopf, deine Gedanken werden zu meinen Gedanken, deine Silben legen sich in meinen Mund.
Ich lese und lese und das Konstrukt aus Buchstaben, das du geschaffen hast, entsteht in meinem Inneren wieder. Jeder Buchstabe ist ein Ziegelstein, jedes Wort ein Stützpfeiler, jeder Satz ein Dach.
Von schwarz auf weiß wird es zu bunt in mir. Ich übertrage alles, eine Blaupause deiner Worte. Sie bleiben in mir, auch wenn ich deinen Brief wieder falte, wieder in den Umschlag stecke, die Druckertinte aus meinem Blickfeld verschwindet. Die Silhouette der Buchstaben geistert durch meinen Kopf. Dein Haus, mein Haus bleibt bestehen.
Aus dem Schornstein der h's quillt weißer Rauch, Wärme breitet sich in mir aus. In dem Haus in mir sitzt jemand und hat es gemütlich, genießt Gemeinsamkeit. In den Fenstern der o's brennt Licht. Lachen mischt sich mit ruhiger Freundlichkeit.
Schwarz auf weiß stehen die Worte. Und sie sind noch so viel mehr.
So viele Augen schauen mich an. So viele Buchstaben wollen mir etwas sagen.
Wort für Wort leiten sie mich durch die Sprache. Wort für Wort formen sich Bilder in meinem Kopf, deine Gedanken werden zu meinen Gedanken, deine Silben legen sich in meinen Mund.
Ich lese und lese und das Konstrukt aus Buchstaben, das du geschaffen hast, entsteht in meinem Inneren wieder. Jeder Buchstabe ist ein Ziegelstein, jedes Wort ein Stützpfeiler, jeder Satz ein Dach.
Von schwarz auf weiß wird es zu bunt in mir. Ich übertrage alles, eine Blaupause deiner Worte. Sie bleiben in mir, auch wenn ich deinen Brief wieder falte, wieder in den Umschlag stecke, die Druckertinte aus meinem Blickfeld verschwindet. Die Silhouette der Buchstaben geistert durch meinen Kopf. Dein Haus, mein Haus bleibt bestehen.
Aus dem Schornstein der h's quillt weißer Rauch, Wärme breitet sich in mir aus. In dem Haus in mir sitzt jemand und hat es gemütlich, genießt Gemeinsamkeit. In den Fenstern der o's brennt Licht. Lachen mischt sich mit ruhiger Freundlichkeit.
Schwarz auf weiß stehen die Worte. Und sie sind noch so viel mehr.
Abonnieren
Posts (Atom)