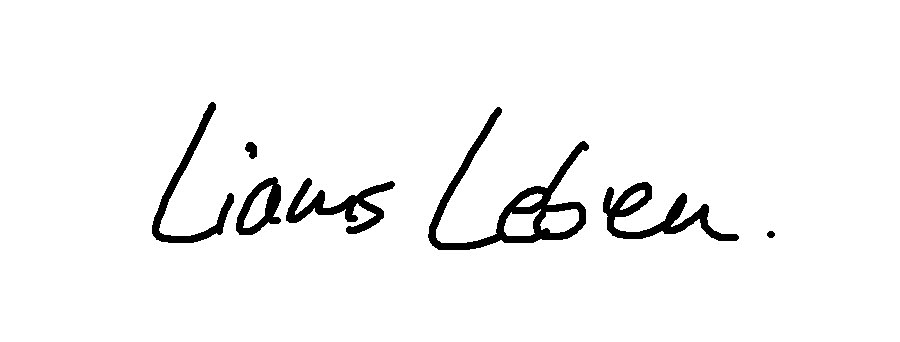Im Kampf mit mir selbst steht
Ja gegen Nein
Geh gegen Bleib
Mach gegen Lass.
In mir sind zwei Seiten. Die eine will Skillet hören, die andere Philipp Poisel. Also springe ich auf YouTube hin und her, zwischen dem einen und dem anderen Lied, der einen und der anderen Band.
Bei ruhigen Liedern fühle ich mich unausgeglichen, will mehr Action, will mehr hören, geht mir alles zu langsam, alles zu sanft, alles zu still.
Bei schnellen Liedern fühle ich mich unverstanden, überfordert mit der Welt, alles geht zu schnell, alles ist zu laut, ich verstehe nichts und höre mich selbst nicht mehr.
Ich kann es mir nicht recht machen. Weil nie beide Seiten glücklich sind.
Und plötzlich stehe ich mit dem Messer in der Hand da, das kalte Metall an meiner nackten Haut. Ich realisiere, wo ich bin; ich realisiere, wer ich bin. Und lege das Messer zurück.
Und hebe das Messer wieder auf. Und dann wieder nicht.
Gut gegen Böse
Glück gegen Pech
Ja gegen Nein.
Ich lege die Klinge in den Schrank und schließe die Tür. Heute gewinnt ein Nein, ein Lass, ein kleines bisschen Glück.
Ein Teil von mir hat gewonnen und versucht zu verdrängen, dass ein anderer Teil verloren hat. Ich drehe Skillet auf und höre nicht auf die Einwände der Gegenseite.
Ein Kampf mit mir selbst ist immer auch ein Kampf gegen mich selbst. Anstrengend. Und ich kann nur verlieren, nur gewinnen.
"And when the scars heal, the pain passes,
As hope burns, we rise from the ashes!
Darkness fades away!
And the light shines on a brave new day!
Our future's here and now,
Here comes the countdown!"
[Skillet]
Mittwoch, 20. November 2013
Dienstag, 19. November 2013
Wolken beobachten.
Auf dem Gras liegen und den Wolken beim Fliegen zusehen. Bilder erkennen, Tiere entdecken, Gesichter erahnen. Weil aus den weißen Wolkenbergen plötzlich Gestalten werden. In meiner Fantasie, in deiner Fantasie.
Wir liegen nur still da. Reden nicht. Sind nur beisammen, schweigen gemeinsam.
Wir sehen denselben Himmel, liegen auf demselben Boden und blicken in dieselbe Richtung. Trotzdem entdecken wir Unterschiedliches.
Ob du wohl auch den großen Dino siehst, der über den blauen Himmel trabt? Der jetzt seinen Hals reckt, seine Flügel ausstreckt und dann auseinanderfällt, in nichts als weiße Fetzen?
Ob du auch die Hand erkennst, die sich durch die Welt da oben schiebt, die nach allem greift, die Finger streckt und streckt und streckt und dann beim Greifen zerreißt?
Du siehst auch das Herz, was ich sehe. Ganz eindeutig, weiß auf blau. Wir wenden den Blick vom Schauspiel des Himmels, lächeln uns an, ein Kuss. Und die Welt ist wundervoll.
Wir liegen nur still da. Reden nicht. Sind nur beisammen, schweigen gemeinsam.
Wir sehen denselben Himmel, liegen auf demselben Boden und blicken in dieselbe Richtung. Trotzdem entdecken wir Unterschiedliches.
Ob du wohl auch den großen Dino siehst, der über den blauen Himmel trabt? Der jetzt seinen Hals reckt, seine Flügel ausstreckt und dann auseinanderfällt, in nichts als weiße Fetzen?
Ob du auch die Hand erkennst, die sich durch die Welt da oben schiebt, die nach allem greift, die Finger streckt und streckt und streckt und dann beim Greifen zerreißt?
Du siehst auch das Herz, was ich sehe. Ganz eindeutig, weiß auf blau. Wir wenden den Blick vom Schauspiel des Himmels, lächeln uns an, ein Kuss. Und die Welt ist wundervoll.
Mittwoch, 13. November 2013
Zeig mir deine Arme.
Zeig mir, was unter deinen Ärmeln liegt.
Zeig mir deine nackte Haut, zeig mir deine Arme.
Ich höre den Geschichten zu, die deine Narben mir erzählen. Ich fühle den Schmerz mit dir, den du erlebst. Ich kleb dir ein Pflaster auf die Überreste deines Leids. Ich mal dir einen Schmetterling auf die blasse Haut. Der nicht sterben darf. Der leben will, davonfliegen, sich aufmachen, auf den Weg in eine bessere Welt. Auf den Weg bring ich dich.
Ich schreib dir Liebe auf die Arme und reich dir die Hand. Ich halte dich fest, lass dich nicht los. Halte die Finger, die zur Klinge greifen.
Ich schlag mit dir auf Wände ein, wenn die Wut zu stark ist. Ich renne mit dir durch den Regen, wenn der Druck zu groß ist. Ich bleib mit dir liegen, wenn nichts mehr geht. Und zieh dich auf die Beine, wenn du es selbst nicht mehr kannst.
Ich nehm dich in die Arme. Errichte Mauern um dich, ein Bollwerk, eine eigene kleine Burg. In die kein Feind, kein feindliches Gefühl Einzug erhält.
Ich stehe hier und bleibe hier.
Zeig mir deine Arme. Und ich zeig dir meine.
Zeig mir deine nackte Haut, zeig mir deine Arme.
Ich höre den Geschichten zu, die deine Narben mir erzählen. Ich fühle den Schmerz mit dir, den du erlebst. Ich kleb dir ein Pflaster auf die Überreste deines Leids. Ich mal dir einen Schmetterling auf die blasse Haut. Der nicht sterben darf. Der leben will, davonfliegen, sich aufmachen, auf den Weg in eine bessere Welt. Auf den Weg bring ich dich.
Ich schreib dir Liebe auf die Arme und reich dir die Hand. Ich halte dich fest, lass dich nicht los. Halte die Finger, die zur Klinge greifen.
Ich schlag mit dir auf Wände ein, wenn die Wut zu stark ist. Ich renne mit dir durch den Regen, wenn der Druck zu groß ist. Ich bleib mit dir liegen, wenn nichts mehr geht. Und zieh dich auf die Beine, wenn du es selbst nicht mehr kannst.
Ich nehm dich in die Arme. Errichte Mauern um dich, ein Bollwerk, eine eigene kleine Burg. In die kein Feind, kein feindliches Gefühl Einzug erhält.
Ich stehe hier und bleibe hier.
Zeig mir deine Arme. Und ich zeig dir meine.
Sonntag, 10. November 2013
Es brennt in mir.
In mir brennt ein Feuer. Es verzehrt mich, es frisst mich auf, es brennt alles nieder.
Es ist heiß und ich spüre, wie es in mir lodert. Wie es alles angreift, was dort lebt. Wie es meine Organe zu Staub zerlegt. Wie es meine Gefühle in Asche verwandelt. Wie es mich attackiert, von innen heraus.
Ich kann es nicht sehen, ich komme nicht an es heran. Und kann es deswegen nicht löschen. Ich kann nichts retten, kann mich nicht vor den alles verzehrenden Flammen beschützen.
Ich merke, es ist da. Und kann doch nichts tun. Auch wenn ich alles probiere.
Ich versuche, die Flammen zu ersticken. Ich halte die Luft an und atme nicht mehr, damit kein Sauerstoff an den Brandherd gelangt. Aber es bringt nichts. Ich halte es nicht lange genug durch. Wenn ich nach 30 Sekunden wieder nach Luft schnappe, lodert auch das Feuer wieder auf.
Ich versuche, den Brand mit Wasser zu löschen. Ich trinke und trinke, spüle alles runter, damit das Feuer in der Flut erlischt. Es ist nicht möglich. Das, was in mir brennt, ist resistent. Es ist haltbar. Es will nicht sterben. Es will seine lodernden Flammen nicht besiegt wissen. Es will vernichten.
Alles, was in mir ist. Alles, was in mir lebt, will es töten. Das Feuer frisst sich durch mich hindurch. Aber es zeigt sich nicht. Es ist in mir. Es flackert versteckt. Sodass nur ich es spüren kann. Nur ich weiß, es ist da.
In mir brennt ein Feuer. Und trotzdem friere ich.
Es ist nicht wärmend, es spendet kein Leben. Es ist ein kalter Brand. Der nicht gelöscht werden kann, solange ich lebe. Die Flammen ernähren sich von mir.
In mir brennt mein Feuer.
Mittwoch, 6. November 2013
Bruder.
Es ist Schulschluss. Endlich. Ich trabe mit meinen Freunden langsam über den Schulhof. Wir weichen Fünftklässlern aus, die sich über den Platz jagen, Sechstklässlern und ihren Fußbällen, Siebtklässlern, die in kleinen Gruppen zusammenstehen und sich ausgiebig voneinander verabschieden.
Da kommt was Kleines angelaufen. Es boxt mir gegen die Schulter. Es sagt: "Moooin!" und streckt seine Hand zum High Five aus.
Meine Freunde grinsen und ich wende mich dem Kleinen zu. Er beginnt zu erzählen. Von Wettkämpfen und Klassenarbeiten, von seinen Freunden und seinem Wochenende.
Ich höre zu, bleibe still, nicke und ich freue mich.
"Fahren wir zusammen?", fragt er mich auf dem Weg zu den Fahrradständern.
Klar, machen wir. Warum nicht.
Also Tschüss zu meinen Freunden, tschüss zur Schule, schnell dem Kleinen hinterher. Der ist schon meterweit voraus, schließt schon sein Fahrrad auf. Aber er wartet auch gerne auf mich, hat es nicht eilig, grinst mich an, als wir dann endlich starten.
Nebeneinander, durch den grauen November. Er atmet schwer, tritt fleißig in die Pedale, um Schritt zu halten und redet dabei ununterbrochen. Er erzählt mir sein Leben, will in 10 Minuten alles loswerden, was er erlebt.
Ich bin einfach da, fahre meinen Weg, schaue immer mal wieder zu ihm rüber, füge in seine Redepausen ein "cool!" ein "wow!" ein "ja, krass!" ein.
Einige Kreuzungen, Ampeln, Zebrastreifen und ganz viel Erzählen später, trennen sich unsere Wege. Er überquert die Straße und ruft mir zwischen den Autos ein lautes "Tschööö, Bro!" zu und entfernt sich dann, fährt rasend weiter, auf dem Weg zur nächsten Mission.
Tschüss! Schön, dass es dich gibt, kleiner Bruder!
"Sometimes being a brother is even better than being a superhero."
[Marc Brown]
Da kommt was Kleines angelaufen. Es boxt mir gegen die Schulter. Es sagt: "Moooin!" und streckt seine Hand zum High Five aus.
Meine Freunde grinsen und ich wende mich dem Kleinen zu. Er beginnt zu erzählen. Von Wettkämpfen und Klassenarbeiten, von seinen Freunden und seinem Wochenende.
Ich höre zu, bleibe still, nicke und ich freue mich.
"Fahren wir zusammen?", fragt er mich auf dem Weg zu den Fahrradständern.
Klar, machen wir. Warum nicht.
Also Tschüss zu meinen Freunden, tschüss zur Schule, schnell dem Kleinen hinterher. Der ist schon meterweit voraus, schließt schon sein Fahrrad auf. Aber er wartet auch gerne auf mich, hat es nicht eilig, grinst mich an, als wir dann endlich starten.
Nebeneinander, durch den grauen November. Er atmet schwer, tritt fleißig in die Pedale, um Schritt zu halten und redet dabei ununterbrochen. Er erzählt mir sein Leben, will in 10 Minuten alles loswerden, was er erlebt.
Ich bin einfach da, fahre meinen Weg, schaue immer mal wieder zu ihm rüber, füge in seine Redepausen ein "cool!" ein "wow!" ein "ja, krass!" ein.
Einige Kreuzungen, Ampeln, Zebrastreifen und ganz viel Erzählen später, trennen sich unsere Wege. Er überquert die Straße und ruft mir zwischen den Autos ein lautes "Tschööö, Bro!" zu und entfernt sich dann, fährt rasend weiter, auf dem Weg zur nächsten Mission.
Tschüss! Schön, dass es dich gibt, kleiner Bruder!
"Sometimes being a brother is even better than being a superhero."
[Marc Brown]
Abonnieren
Posts (Atom)