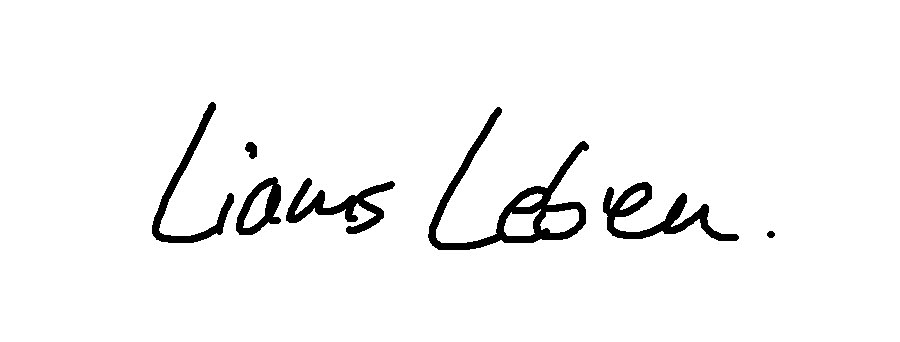Wie ein Ziegelstein in meinem Bauch.
Er quetscht meinen Magen, drückt von innen gegen meine Haut. Ich versuche, ihn auszukotzen. Aber es geht nicht. Ich versuche, ihn rauszuschneiden, aber es geht nicht. Er ist da. Und ich habe das Gefühl, er wächst. Ein wachsender, immer schwerer werdender Stein. Mir ist übel, jeden Tag. Es ist kein Ziegelstein, es ist ein Tumor-Stein. Bösartig und grausam, er greift nicht meine Zellen an, sondern mein Herz, meine Seele, mein Gehirn, das, was mich ausmacht, das, was ich bin, was mich am Leben hält.
Ich atme schwer und immer schwerer, weil er meine Organe zerquetscht, meine Lunge zermalmt, ihr den Platz zum Atmen nimmt. Manchmal habe ich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Ich habe das Gefühl, zu ersticken, auch wenn der Wind um mich in Böen weht.
Der Ziegelstein-Tumor vermehrt sich und streut kleine neue Ziegelstein-Tumoren. Sie wandern durch meinen Körper, wandern in meine Beine, die ich nicht mehr heben kann. Ich kann nicht mehr gehen, nicht mehr einen Fuß vor den anderen setzen. Meine Arme werden schwer, ich kann nicht mehr schreiben, nichts mehr greifen, sie hängen nutzlos an mir hinab.
Wie eine eiserne Fessel, die meine Knochen hält.
All die Ziegelsteine vereinen sich und werden zu einem langen Glied, das durch meinen Körper wächst. Die Kette zieht sich immer enger zu, drückt und drückt und drückt. Sie nimmt mir die Luft zum Atmen, die Freiheit zu denken, die Kraft zum Leben. Und sie bindet mich an, wie einen streunenden Hund. Ich bin ein Gefangener meiner Gedanken, ich bin mein eigener Käfig, ich komme nicht von ihm los.
Wie ein Rucksack voller Beton, den ich immer bei mir trage.
Ich wiege eine Tonne und noch mehr. Ich bin ein Elefant. Grau in grau und schwer und schwerfällig. Ich stapfe durch die Welt.
Stapf. Stapf. Stapf.
Und dann falle ich auf den Boden, alle Viere von mir gestreckt. Wie ein verendetes Tier liege ich da und bewege mich nicht.
Aber ich stehe wieder auf und ich will mich nicht beschweren. Manche tragen ein leichtes Federkleid, andere Ziegelsteine und Beton.
Mittwoch, 29. Januar 2014
Samstag, 25. Januar 2014
Der Film.
Ich sitze da und lächle, bin irgendwie zufrieden, irgendwie glücklich.
Und auf einmal beginnt ein Film in mir zu laufen. Erinnerungen schießen in meinen Kopf und spielen sich ab. Sie sind real wie immer. Ich höre die Stimmen von damals, sehe alles in 3D, rieche die Gerüche, fühle alles so wie damals. Ich kann die Bilder nicht stoppen. Ich weiß, sie laufen weiter, bis ich alles gesehen habe. Sie laufen bis zum Ende. Es ist Play ohne Stopp-Taste. Es ist ein schlechter Film mit kaputter Fernbedienung, den man nicht beenden kann. Ich kann nicht fliehen. Denn die Leinwand ist meine Kopfwand.
Als hätte mir jemand in den Magen geboxt, genauso fühle ich mich. Mir ist übel. Ich habe das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Ich möchte die Gedanken auskotzen, die sich in mir verbreiten. Ich will den Film in die Toilette spucken und dann die Spülung drücken, sehen wie das Wasser die Bilder besiegt, sie ertränkt und mit sich reißt. Weit weg von mir.
Als hätte ich Säure geschluckt, so geht es mir. Irgendwie habe ich etwas in meinem Körper, was mich von innen heraus vergiftet und verätzt. Meine Organe sind dem ausgesetzt. Ich kann sie nicht retten. Es fühlt sich an, als würde mein Herz sich zusammenziehen und verengen, es kämpft gegen den Eindringling und schlägt immer schneller, immer schmerzhafter, immer pochender. Es hallt in meinen Ohren. Bummbummbummbumm. Meine Lunge kann den Sauerstoff nicht mehr verarbeiten. Ich atme und atme und habe trotzdem Angst, zu ersticken. Ich ersticke an den Gefühlen in mir.
Als hätte mir jemand ein Messer in den Leib gerammt. So verblute ich. Innerlich.
Bis der Film ein Ende gefunden hat, bis das letzte Bild verblasst und der letzte Ton in meinem Kopf verklungen ist. Weil ich dann alles gesehen habe. Der Abspann meines Flashbacks ist aus purer Schwärze; alles, was bleibt, sind die Gefühle und die Angst.
Ich sitze immer noch genau so da, aber irgendwie bin ich nicht mehr glücklich, auf einmal geht's mir schlecht, auch wenn um mich herum alles beim Alten ist.
Und auf einmal beginnt ein Film in mir zu laufen. Erinnerungen schießen in meinen Kopf und spielen sich ab. Sie sind real wie immer. Ich höre die Stimmen von damals, sehe alles in 3D, rieche die Gerüche, fühle alles so wie damals. Ich kann die Bilder nicht stoppen. Ich weiß, sie laufen weiter, bis ich alles gesehen habe. Sie laufen bis zum Ende. Es ist Play ohne Stopp-Taste. Es ist ein schlechter Film mit kaputter Fernbedienung, den man nicht beenden kann. Ich kann nicht fliehen. Denn die Leinwand ist meine Kopfwand.
Als hätte mir jemand in den Magen geboxt, genauso fühle ich mich. Mir ist übel. Ich habe das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Ich möchte die Gedanken auskotzen, die sich in mir verbreiten. Ich will den Film in die Toilette spucken und dann die Spülung drücken, sehen wie das Wasser die Bilder besiegt, sie ertränkt und mit sich reißt. Weit weg von mir.
Als hätte ich Säure geschluckt, so geht es mir. Irgendwie habe ich etwas in meinem Körper, was mich von innen heraus vergiftet und verätzt. Meine Organe sind dem ausgesetzt. Ich kann sie nicht retten. Es fühlt sich an, als würde mein Herz sich zusammenziehen und verengen, es kämpft gegen den Eindringling und schlägt immer schneller, immer schmerzhafter, immer pochender. Es hallt in meinen Ohren. Bummbummbummbumm. Meine Lunge kann den Sauerstoff nicht mehr verarbeiten. Ich atme und atme und habe trotzdem Angst, zu ersticken. Ich ersticke an den Gefühlen in mir.
Als hätte mir jemand ein Messer in den Leib gerammt. So verblute ich. Innerlich.
Bis der Film ein Ende gefunden hat, bis das letzte Bild verblasst und der letzte Ton in meinem Kopf verklungen ist. Weil ich dann alles gesehen habe. Der Abspann meines Flashbacks ist aus purer Schwärze; alles, was bleibt, sind die Gefühle und die Angst.
Ich sitze immer noch genau so da, aber irgendwie bin ich nicht mehr glücklich, auf einmal geht's mir schlecht, auch wenn um mich herum alles beim Alten ist.
Donnerstag, 23. Januar 2014
Proundkontrawinter.
Das Doofe am Winter:
Dauernd ist mir kalt, dauernd fühle ich mich unter schichtenweise Klamotten unwohl und die Kälte kriecht trotzdem durch.
Die Straßen sind glatt und rutschig, man fällt hin, man steht wieder auf, genervt von allem.
Eisessen macht keinen Spaß.
Das Gute am Winter:
Ich trinke ganz viel Tee.
Die Luft ist so klar und so frisch und schmeckt so gut, wie nur Winterfrischluft schmecken kann.
Die Leute sind nicht so gut gelaunt, nicht so anstrengend, nicht so sommerlaunig aktiv.
Oft ist es ruhig.
Das Allerdoofeste am Winter:
Es ist grau und grau in kalter Leblosigkeit, verschneit, vereist, matschig und tot. Die Welt draußen färbt sich ab auf mich. Leblos. Kraftlos. Das Grün fehlt irgendwie an den Bäumen. Das Grün fehlt irgendwie in mir.
Das Allerallerbeste am Winter:
Er geht vorbei und dann kommt der Frühling und dann kommen die Farben und das Lachen zurück. Dann wird es draußen wieder warm, dann wird es in mir wieder warm. Dann sind die Menschen erstersonnenstrahl-glücklich und grinsen.
Dauernd ist mir kalt, dauernd fühle ich mich unter schichtenweise Klamotten unwohl und die Kälte kriecht trotzdem durch.
Die Straßen sind glatt und rutschig, man fällt hin, man steht wieder auf, genervt von allem.
Eisessen macht keinen Spaß.
Das Gute am Winter:
Ich trinke ganz viel Tee.
Die Luft ist so klar und so frisch und schmeckt so gut, wie nur Winterfrischluft schmecken kann.
Die Leute sind nicht so gut gelaunt, nicht so anstrengend, nicht so sommerlaunig aktiv.
Oft ist es ruhig.
Das Allerdoofeste am Winter:
Es ist grau und grau in kalter Leblosigkeit, verschneit, vereist, matschig und tot. Die Welt draußen färbt sich ab auf mich. Leblos. Kraftlos. Das Grün fehlt irgendwie an den Bäumen. Das Grün fehlt irgendwie in mir.
Das Allerallerbeste am Winter:
Er geht vorbei und dann kommt der Frühling und dann kommen die Farben und das Lachen zurück. Dann wird es draußen wieder warm, dann wird es in mir wieder warm. Dann sind die Menschen erstersonnenstrahl-glücklich und grinsen.
Donnerstag, 16. Januar 2014
Musik in dir.
Du schließt die Augen. Und hörst die Musik. Sie ist in dir. Sie durchflutet dich. Sie zeigt dir, was du fühlst. Sie ist perfekt. Weil sie so unfertig ist. Da sind Pausen zwischen, Lücken, Notensprünge, die du nicht einordnen kannst, die es so nicht geben kann und nie geben wird. Klangfarben, die auf keinem Instrument gespielt werden können. Es ist laut. Und es ist leise. Zugleich.
Du kannst die Töne nicht greifen, sie bleiben nicht. Kaum hörst du etwas Wundervolles, verklingen die Akkorde und etwas Neues beginnt. Nichts bleibt bestehen. Außer die ewige Melodie.
Und vor deinem inneren Auge bauen sich Bilder auf. Bilder von dir, wie du rennst. Bilder von dir, wie du stehst. Bilder von dir, wie du lächelst, wie du weinst, wie du denkst, wie du wütend bist, wie du einfach nur dasitzt und deinem Atem lauschst
Das bist du jetzt. Mit geschlossenen Augen. Und alles ist still. Der letzte laute Schlussakkord deines Orchesters verklingt, nur das rhythmische Klicken des Metronoms bleibt. Bis du die Augen öffnest und realisierst, das ist die Uhr. Tick. Tack. Tick. Tack.
Du kannst die Töne nicht greifen, sie bleiben nicht. Kaum hörst du etwas Wundervolles, verklingen die Akkorde und etwas Neues beginnt. Nichts bleibt bestehen. Außer die ewige Melodie.
Und vor deinem inneren Auge bauen sich Bilder auf. Bilder von dir, wie du rennst. Bilder von dir, wie du stehst. Bilder von dir, wie du lächelst, wie du weinst, wie du denkst, wie du wütend bist, wie du einfach nur dasitzt und deinem Atem lauschst
Das bist du jetzt. Mit geschlossenen Augen. Und alles ist still. Der letzte laute Schlussakkord deines Orchesters verklingt, nur das rhythmische Klicken des Metronoms bleibt. Bis du die Augen öffnest und realisierst, das ist die Uhr. Tick. Tack. Tick. Tack.
Mittwoch, 15. Januar 2014
Gefragt.
"Ein neues Leben kannst du nicht anfangen, aber täglich einen neuen Tag."
[Henry David Thoreau]
Ich tagge nichts und niemanden, aber, wie versprochen, antworte ich auf deine Fragen, weakheart!
[Henry David Thoreau]
Ich tagge nichts und niemanden, aber, wie versprochen, antworte ich auf deine Fragen, weakheart!
1. Wann warst du das letzte Mal glücklich?
Heute irgendwann, im Laufe des Tages
2. Wolltest du dich schon einmal umbringen?
Ja
Ja
3. Denkst du viel über unsere Gesellschaft nach?
Das ist relativ, aber ich denke generell viel nach, über alles und jeden - also ja, auch über unsere Gesellschaft
Das ist relativ, aber ich denke generell viel nach, über alles und jeden - also ja, auch über unsere Gesellschaft
4. Hättest du einen Wunsch frei, wie würde der aussehen?
Zufrieden sein
Zufrieden sein
5. Wie ist das Verhältnis zu deiner Familie?
Meine Familie besteht aus mehreren Teilen; zu manchen Teilen gut, zu manchen so lala
6. Falls du in einer ES bist, was war dein niedrigster BMI?
Nein
Nein
7. Warst du schon einmal auf einem Festival?
Nein
Nein
8. Würdest du etwas in deinem Leben rückgängig machen? Wenn ja, was?
Sicherlich. Ich hätte ein paar Menschen weniger belogen, ein paar Menschen weniger verletzt, wäre ein bisschen entschlossener gewesen, hätte mehr auf mein Herz gehört. Aber das Leben läuft eben nicht rückwärts. Und das ist auch ok so.
Sicherlich. Ich hätte ein paar Menschen weniger belogen, ein paar Menschen weniger verletzt, wäre ein bisschen entschlossener gewesen, hätte mehr auf mein Herz gehört. Aber das Leben läuft eben nicht rückwärts. Und das ist auch ok so.
9. Sprichst du mit deinen Freunden über deine Gefühle, Ängste?
Nein, eher weniger
Nein, eher weniger
10. Wie würdest du deinen Kleidungsstil beschreiben?
Jeans und T-Shirt (+ Sweatjacke)
Jeans und T-Shirt (+ Sweatjacke)
11. Hast du Piercings, Tattoos und/oder Tunnel? Wenn ja, was für welche?
Nein
Dienstag, 14. Januar 2014
Was Glück braucht.
Vielleicht braucht Glück Mut.
Vielleicht ist dieser eine letzte Schritt notwendig, dieser eine Moment des Aufbruchs. Die Flucht aus dem Alltäglichen, die Suche nach etwas Neuem.
Eine Überwindung, ein kleiner Kick, der die Lawine des Glücks anstößt. Die einen dann unaufhaltsam überrollt. Die einen verschlingt. Mit nichts als Euphorie, strahlendem Lächeln, Bauchkribbeln und dem Gefühl, die Freude in die Luft schreien zu wollen.
Vielleicht braucht Glück Erfolge.
Vielleicht nicht die großen, riesigen Schritte, vielleicht nicht die besten Noten, vielleicht nicht den ersten Platz. Aber etwas, worauf man stolz sein kann. Etwas, was zufrieden macht. Was das Gefühl gibt, das Richtige getan zu haben.
Ein aufmunterndes Wort, was Tränen getrocknet hat. Eine Anstrengung, die sich gelohnt hat. Ein Weg, der zum Ziel geführt hat.
Vielleicht braucht Glück den Zufall.
Vielleicht ist es egal, was man tut. Vielleicht zählt das alles nicht. Vielleicht kommt Glück von heut auf morgen, von hier und dort, zu diesem und jenem.
Man muss nur zur richtigen Stelle am richtigen Ort stehen, das Richtige denken und das Richtige tun. Zufällig.
Wenn das so ist, dann braucht Glück vor allem Glück.
Vielleicht ist dieser eine letzte Schritt notwendig, dieser eine Moment des Aufbruchs. Die Flucht aus dem Alltäglichen, die Suche nach etwas Neuem.
Eine Überwindung, ein kleiner Kick, der die Lawine des Glücks anstößt. Die einen dann unaufhaltsam überrollt. Die einen verschlingt. Mit nichts als Euphorie, strahlendem Lächeln, Bauchkribbeln und dem Gefühl, die Freude in die Luft schreien zu wollen.
Vielleicht braucht Glück Erfolge.
Vielleicht nicht die großen, riesigen Schritte, vielleicht nicht die besten Noten, vielleicht nicht den ersten Platz. Aber etwas, worauf man stolz sein kann. Etwas, was zufrieden macht. Was das Gefühl gibt, das Richtige getan zu haben.
Ein aufmunterndes Wort, was Tränen getrocknet hat. Eine Anstrengung, die sich gelohnt hat. Ein Weg, der zum Ziel geführt hat.
Vielleicht braucht Glück den Zufall.
Vielleicht ist es egal, was man tut. Vielleicht zählt das alles nicht. Vielleicht kommt Glück von heut auf morgen, von hier und dort, zu diesem und jenem.
Man muss nur zur richtigen Stelle am richtigen Ort stehen, das Richtige denken und das Richtige tun. Zufällig.
Wenn das so ist, dann braucht Glück vor allem Glück.
Sonntag, 12. Januar 2014
Was vom Träumen übrig bleibt.
Ich schlage die Augen auf. Durch die geöffneten Vorhänge strömt Licht in mein Zimmer. Die Januarsonne strahlt und strahlt und feuert all ihre Wärme ab. Es ist ein schöner Morgen, es wird ein schöner Tag.
Und ich liege hier und bewege mich nicht. Ich schaffe es nicht, die Schönheit des Morgens zu realisieren. Alles, was ich empfinde, sind die Reste der Träume, die noch an mir kleben. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich weiß nicht, wo ich in der Nacht gewesen bin, in welchem Teil meines Kopfes ich unterwegs war. Ich weiß nur, dass es anstrengend gewesen sein muss.
Mein Körper fühlt sich an wie nach einem Marathon. Ich fühle mich ausgelaugt und erschöpft. Ich spüre so ein ungutes Gefühl in meinem Magen, als würde ich verfolg werden, als hätte ich Angst, als wäre etwas los, als müsste ich etwas fürchten.
Und ich richte mich schlagartig auf. Mein Bett ist durchwühlt. Mein Körper schweißnass. Ich habe Angst. Und ich weiß nicht, wovor. Ich bin gerannt, aber ich weiß nicht, wohin.
Ich presse mir mein Kissen auf den Kopf und versuche, mich zu beruhigen. Ich versuche, mir einzureden, dass alles gut ist. Dass ich im Bett liege. Dass ich mich nicht fürchten muss. Aber es nützt nichts. Mein Kopf ist anderer Meinung.
Also stehe ich auf und schaue auf die Uhr. Ich habe acht Stunden geschlafen. Eigentlich müsste ich zufrieden sein, müsste ich wach sein, frisch und erholt. Aber es ist nicht so.
Auch wenn mein Körper die letzten Stunden im Bett lag und ausgeschaltet war, mein Kopf war es nicht. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber geschlafen hat er nicht.
Unter der Dusche versuche ich, mich zu konzentrieren. Es muss doch möglich sein, mich zu erinnern! Wenn ich schon mit Kopfschmerzen aufwache, wenn mein Schlaf schon ein verdammter Wettlauf ist, wenn ich schon Angst habe, dann will ich wenigstens wissen, wovor!
Aber bis es soweit ist, bis ich mich erinnern kann, ist alles, was vom Träumen übrig bleibt, Angst und Ungewissheit.
Abonnieren
Posts (Atom)