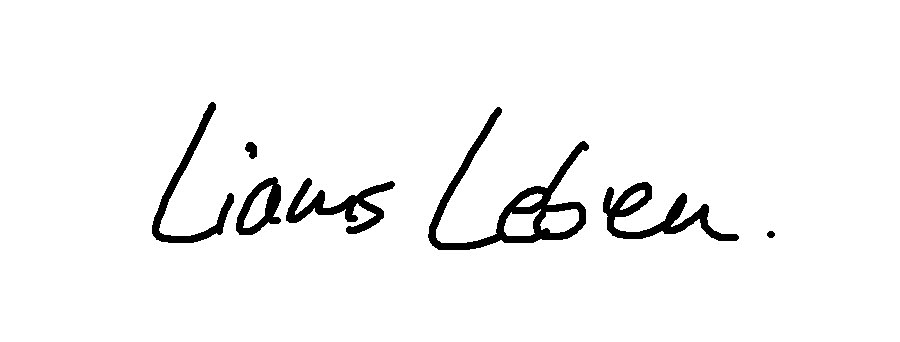Es ist, als hätte jemand ein Glas schwarzer Tinte über mir vergossen.
Ein kleiner Tropfen trifft auf meine blasse Haut und verfärbt sie schwarz. Tödlich schwarz. Und dann breitet sich der dunkle Fleck zu allen Seiten aus. Er wird immer größer und größer.
Die Farbe sickert durch mich durch, dringt in mich ein, durchweicht mich. Und höhlt mich dabei von innen aus, leert mich und füllt alles mit eisiger, dunkler Kälte auf.
Ich hebe die Hände und versuche, das Schwarz aufzuwischen, von meinem Körper zu schieben, ich wringe mich aus wie ein nasses Handtuch. Kämpfe gegen die Infektion, die immer mehr von mir befällt.
Ich hole tief Luft, nehme all die Wärme in mir auf, die ich kriegen kann. Wer weiß, wann die schwarze Pest mein Gesicht erreicht, wann meine Lunge nur noch Dunkelheit in sich aufnehmen kann.
Hilflos blicke ich auf meinen Bauch, wo die Schwärze immer durchdringender wird. Übelkeit breitet sich von dort in meinen gesamten Körper aus. Und mit ihr die Kälte, die mir alles Leben raubt.
Eine Träne löst sich aus meinem Augenwinkel und kullert meinen Körper hinunter, geradewegs auf die schwarze Fläche zu. Ob sie wohl stark genug sein wird, die dunkle Tinte zu verdünnen, aufzulösen, wegzuschwemmen?
Freitag, 28. Juni 2013
Montag, 24. Juni 2013
Rot und grün.
Mein Finger schwebt über dem grünen Kopf. Deine Nummer leuchtet mich vom Display an. Ich merke, wie ich anfange zu schwitzen, wie meine Hand anfängt zu zittern.
Nervös trete ich von einem Fuß auf den anderen. Ich atme tief ein, schließe die Augen. Versuche, mich zu beruhigen.
Doch es funktioniert nicht. Ich bleibe unruhig, aufgekratzt. Ich habe Angst. Mir wird heiß. Ich trete schneller von einem Bein auf das andere.
Das Telefon liegt schwer und heiß in meiner Hand. Ich lasse meinen Arm sinken und lege es auf das Fensterbrett. Hüpfe zweimal, laufe durch mein Zimmer. Von einer Wand zur anderen. Sechs schnelle Schritte. Hin und her. Hüpfe wieder. Schüttele mich. Ich versuche, alles abzuschütteln. All die Anspannung, all die Nervosität, all die Übelkeit, die in mir aufsteigt.
Ich habe das Gefühl, mich übergeben zu müssen und laufe zur Tür. Als meine Hand das kalte Metall der Türklinke berührt, bleibe ich wie angewurzelt stehen.
Ich erstarre. Wie zu Eis erfroren.
Nein.
Ich werde jetzt nicht gehen. Ich werde die Tür nicht öffnen. Ich werde nicht flüchten. Dieses Mal nicht.
Also schlucke ich den bitteren Geschmack in meinem Mund herunter und stelle mich wieder ans Fensterbrett. Nehme den Hörer wieder in die Hand. Spüre wieder den Schweiß auf meinen Händen.
Ich blicke auf deine Nummer. Auf die Knöpfe. Und drücke auf den roten Knopf.
Aus.
Mein Blick schweift aus dem Fenster. Auf die Regentropfen, die leise vom Himmel fallen. Die Bäume, die ruhig im Wind tanzen. Die Häuser der Nachbarn, die wie Felsen in der Brandung stehen. Ich habe das Gefühl, als wären die Fenster Augen, die mich beobachten. Die mich mit bösen Blicken strafen. Ich halte dem nicht stand und wende mich ab.
Jetzt blicke ich auf die Tür. Die verschlossen ist. Und die ich nicht mehr öffnen wollte. Nicht bevor ich dich angerufen habe.
Ich laufe auf sie zu. Auf die braune Wand mit der goldenen Klinke. Vier Schritte. Meine Hand kracht dröhnend gegen das Holz. Vier Schritte zurück. Meine Hand greift das Telefon.
Ich muss es tun und wähle deine Nummer. Erneut. Erneut blickt sie mich auffordernd vom Display an. Ruf mich an! Wähl mich! Sprich mit mir!
Das Zittern breitet sich auf meinen gesamten Körper aus. Ich kann den Hörer kaum mehr halten. Lehne mich gegen das Fensterbrett. Schließe die Augen.
Und reiße sie dann wieder auf. Stampfe mit dem Fuß auf den Boden. Beiße die Zähne zusammen.
Und presse meinen Daumen auf den grünen Knopf.
Tut.
Hoffentlich geht keiner ran.
Tut.
Es ist keiner da.
TUT.
Ich hab's probiert, lege sofort wieder auf.
"Hallo?"
Scheiße.
Nach 3 Minuten und 47 Sekunden drücke ich mit allerletzter Kraft auf den roten Knopf. Ich kann nicht mehr. Meine Beine geben nach. Ich sinke zu Boden. Lege mich hin. Kann nie mehr aufstehen.
All die Anspannung fällt von mir ab. Alles löst sich in Luft auf. Alles schwindet. Und ich schwinde mit.
Ich robbe zu meinem CD-Player und drücke auf Play.
Tell me when I'm gonna live again
Tell me when this fear will end
Tell me when I'm gonna feel inside
Tell me when I'll feel alive
[Skillet]
Nervös trete ich von einem Fuß auf den anderen. Ich atme tief ein, schließe die Augen. Versuche, mich zu beruhigen.
Doch es funktioniert nicht. Ich bleibe unruhig, aufgekratzt. Ich habe Angst. Mir wird heiß. Ich trete schneller von einem Bein auf das andere.
Das Telefon liegt schwer und heiß in meiner Hand. Ich lasse meinen Arm sinken und lege es auf das Fensterbrett. Hüpfe zweimal, laufe durch mein Zimmer. Von einer Wand zur anderen. Sechs schnelle Schritte. Hin und her. Hüpfe wieder. Schüttele mich. Ich versuche, alles abzuschütteln. All die Anspannung, all die Nervosität, all die Übelkeit, die in mir aufsteigt.
Ich habe das Gefühl, mich übergeben zu müssen und laufe zur Tür. Als meine Hand das kalte Metall der Türklinke berührt, bleibe ich wie angewurzelt stehen.
Ich erstarre. Wie zu Eis erfroren.
Nein.
Ich werde jetzt nicht gehen. Ich werde die Tür nicht öffnen. Ich werde nicht flüchten. Dieses Mal nicht.
Also schlucke ich den bitteren Geschmack in meinem Mund herunter und stelle mich wieder ans Fensterbrett. Nehme den Hörer wieder in die Hand. Spüre wieder den Schweiß auf meinen Händen.
Ich blicke auf deine Nummer. Auf die Knöpfe. Und drücke auf den roten Knopf.
Aus.
Mein Blick schweift aus dem Fenster. Auf die Regentropfen, die leise vom Himmel fallen. Die Bäume, die ruhig im Wind tanzen. Die Häuser der Nachbarn, die wie Felsen in der Brandung stehen. Ich habe das Gefühl, als wären die Fenster Augen, die mich beobachten. Die mich mit bösen Blicken strafen. Ich halte dem nicht stand und wende mich ab.
Jetzt blicke ich auf die Tür. Die verschlossen ist. Und die ich nicht mehr öffnen wollte. Nicht bevor ich dich angerufen habe.
Ich laufe auf sie zu. Auf die braune Wand mit der goldenen Klinke. Vier Schritte. Meine Hand kracht dröhnend gegen das Holz. Vier Schritte zurück. Meine Hand greift das Telefon.
Ich muss es tun und wähle deine Nummer. Erneut. Erneut blickt sie mich auffordernd vom Display an. Ruf mich an! Wähl mich! Sprich mit mir!
Das Zittern breitet sich auf meinen gesamten Körper aus. Ich kann den Hörer kaum mehr halten. Lehne mich gegen das Fensterbrett. Schließe die Augen.
Und reiße sie dann wieder auf. Stampfe mit dem Fuß auf den Boden. Beiße die Zähne zusammen.
Und presse meinen Daumen auf den grünen Knopf.
Tut.
Hoffentlich geht keiner ran.
Tut.
Es ist keiner da.
TUT.
Ich hab's probiert, lege sofort wieder auf.
"Hallo?"
Scheiße.
Nach 3 Minuten und 47 Sekunden drücke ich mit allerletzter Kraft auf den roten Knopf. Ich kann nicht mehr. Meine Beine geben nach. Ich sinke zu Boden. Lege mich hin. Kann nie mehr aufstehen.
All die Anspannung fällt von mir ab. Alles löst sich in Luft auf. Alles schwindet. Und ich schwinde mit.
Ich robbe zu meinem CD-Player und drücke auf Play.
Tell me when I'm gonna live again
Tell me when this fear will end
Tell me when I'm gonna feel inside
Tell me when I'll feel alive
[Skillet]
Sonntag, 23. Juni 2013
Aus Angst.
Nein, ich will nicht schlafen.
Aus Angst, dass die Dämonen mich holen.
Aus Angst, dass die Dunkelheit aus Angst Panik macht.
Aus Angst. Wird Panik. Wird meine ganz eigene Phobie.
Aus Angst. Lasse ich die Lichter an. Die große Lampe an der Decke. Die Schreibtischlampe. Der kleine Stern über meinem Bett. Ich erleuchte jeden Winkel in meinem Zimmer. Jeden Winkel in mir.
Ich will keine Schatten, in denen Dämonen sich verstecken. Will keine schwarzen Flecken an den Wänden, die aussehen wie Gestalten.
Will nicht. Allein sein mit mir. Aus Angst vor mir.
Ich bin müde.
Aber ich kann nicht schlafen wollen.
Aus Angst.
Aus Angst, dass die Dämonen mich holen.
Aus Angst, dass die Dunkelheit aus Angst Panik macht.
Aus Angst. Wird Panik. Wird meine ganz eigene Phobie.
Aus Angst. Lasse ich die Lichter an. Die große Lampe an der Decke. Die Schreibtischlampe. Der kleine Stern über meinem Bett. Ich erleuchte jeden Winkel in meinem Zimmer. Jeden Winkel in mir.
Ich will keine Schatten, in denen Dämonen sich verstecken. Will keine schwarzen Flecken an den Wänden, die aussehen wie Gestalten.
Will nicht. Allein sein mit mir. Aus Angst vor mir.
Ich bin müde.
Aber ich kann nicht schlafen wollen.
Aus Angst.
Freitag, 21. Juni 2013
In der Grundschule.
Ich sitze in der Mensa der Grundschule und hake ab, wer da ist.
"Ich heiße Michael Jackson!", ruft einer. Ein anderer ist "Moby Dick".
Sie rangeln und schubsen sich, lachen und brüllen einander an. Eine der Lehrerinnen fordert die Kinder auf, sich ruhig zu verhalten. Ich grinse einen Jungen an, der einen anderen am Arm festhält. Es sieht so aus, als würden sie tanzen. Keiner verhält sich ruhig.
Und ich hake weiter ab.
"Niklas aus der 2a"
"Katharina aus der 1b"
"Ey, Tommi, du bist dran!"
"Ähm.. Tom aus der 1c"
Alle beugen sich zu mir und versuchen, ihre Namen auf der Liste zu finden. Manche zeigen nur darauf, ohne etwas zu sagen.
"Jana?", frage ich nach. "Oder Sarah?"
Nach einer Viertelstunde Ansturm wird es ruhiger. Hinter jeden Namen habe ich mein Häkchen gesetzt. All die Moby Dicks und Michael Jacksons sitzen jetzt an ihren Tischen und essen.
Nur wenige bleiben länger als fünf Minuten, ehe sie aufstehen und die Reste von ihren Tellern beschämt in den Mülleimer schütten. Oder nach einem weiteren Schnitzel fragen. Und sich dann ihre Portion Nachtisch holen.
Heute gibt es Pudding. Und Lollis.
Ich werde aus der Position des Beobachters geholt und darum gebeten, die verschweißte Plastikfolie zu öffnen. Klar mache ich das. Gerne. Ja, Nero helfe ich auch. Aber Sabrina war vorher da.
Die Kinder werden jetzt mutiger, sprechen mich an. Den fremden großen Jungen, der in ihrer Mensa sitzt.
"Wer ist dein Bruder?" Hä? Meine Brüder werdet ihr nicht kennen.
"Wie heißt du?" Liam. "Mein Bruder hat auch einen Freund, der Liam heißt." Schön.
"Wie alt bist du?" 18. "Meine Nachbarin wird jetzt bald ... mhh.. 17!" Oh ok, ganz schön alt.
"Kannst du mir ein Spiel rausholen?" Ja, welches denn? "Spielst du mit mir Mikado?" Klar, kann ich machen.
Also spiele ich jetzt Mikado. Und nebenbei öffne ich weiter Lollis. Und beantworte Scherzfragen. Ron und Sophie lachen sich schlapp, wenn ich die Antworten nicht weiß.
"Möchtest du auch einen Lolli?" Möchte ich nicht, aber ich sage trotzdem ja. Sehr nett. Danke.
"Haha, guck mal! Ich gewinne!" Ja, sieht wohl so aus.
Am Ende gewinne ich das Mikado-Spiel. Aber nur ganz knapp. Das ist Katharina eh nicht mehr so wichtig; sie zeigt mir jetzt ein Bild, das sie gemalt hat. Sehr schön ist es. Gefällt mir sehr gut.
Pia und Karolina erzählen mir von ihren letzten Tagen in der Schule. Sie sind jetzt in der vierten Klasse, nach den Ferien werden sie die Schule wechseln. Oh ja, sie freuen sich darauf, endlich groß zu sein.
Kian kommt nach den Ferien in die zweite Klasse. Auch er fühlt sich groß. Und stark.
"Ich geh jetzt nach Hause!", rufen zwei Jungen und rennen hinaus.
Andere müssen noch warten, bis sie abgeholt werden. Oder gehen hinüber zur Hausaufgabenbetreuung.
Die Mutter meiner Mikado-Spielpartnerin kommt und nickt mir zu. Katharina läuft zu ihr und geht mit ihr hinaus.
"Tschüss!", ruft sie, als sie schon aus der Tür ist.
Tschüss, denke ich. Und schaue dem Mädchen mit dem großen Ranzen hinterher.
Ich hoffe, du wirst ein gutes Leben haben. Ich hoffe es sehr.
Und ein klein wenig hoffe ich auch, dass jemand für mich gehofft hat, als ich so alt war wie du.
"Ich heiße Michael Jackson!", ruft einer. Ein anderer ist "Moby Dick".
Sie rangeln und schubsen sich, lachen und brüllen einander an. Eine der Lehrerinnen fordert die Kinder auf, sich ruhig zu verhalten. Ich grinse einen Jungen an, der einen anderen am Arm festhält. Es sieht so aus, als würden sie tanzen. Keiner verhält sich ruhig.
Und ich hake weiter ab.
"Niklas aus der 2a"
"Katharina aus der 1b"
"Ey, Tommi, du bist dran!"
"Ähm.. Tom aus der 1c"
Alle beugen sich zu mir und versuchen, ihre Namen auf der Liste zu finden. Manche zeigen nur darauf, ohne etwas zu sagen.
"Jana?", frage ich nach. "Oder Sarah?"
Nach einer Viertelstunde Ansturm wird es ruhiger. Hinter jeden Namen habe ich mein Häkchen gesetzt. All die Moby Dicks und Michael Jacksons sitzen jetzt an ihren Tischen und essen.
Nur wenige bleiben länger als fünf Minuten, ehe sie aufstehen und die Reste von ihren Tellern beschämt in den Mülleimer schütten. Oder nach einem weiteren Schnitzel fragen. Und sich dann ihre Portion Nachtisch holen.
Heute gibt es Pudding. Und Lollis.
Ich werde aus der Position des Beobachters geholt und darum gebeten, die verschweißte Plastikfolie zu öffnen. Klar mache ich das. Gerne. Ja, Nero helfe ich auch. Aber Sabrina war vorher da.
Die Kinder werden jetzt mutiger, sprechen mich an. Den fremden großen Jungen, der in ihrer Mensa sitzt.
"Wer ist dein Bruder?" Hä? Meine Brüder werdet ihr nicht kennen.
"Wie heißt du?" Liam. "Mein Bruder hat auch einen Freund, der Liam heißt." Schön.
"Wie alt bist du?" 18. "Meine Nachbarin wird jetzt bald ... mhh.. 17!" Oh ok, ganz schön alt.
"Kannst du mir ein Spiel rausholen?" Ja, welches denn? "Spielst du mit mir Mikado?" Klar, kann ich machen.
Also spiele ich jetzt Mikado. Und nebenbei öffne ich weiter Lollis. Und beantworte Scherzfragen. Ron und Sophie lachen sich schlapp, wenn ich die Antworten nicht weiß.
"Möchtest du auch einen Lolli?" Möchte ich nicht, aber ich sage trotzdem ja. Sehr nett. Danke.
"Haha, guck mal! Ich gewinne!" Ja, sieht wohl so aus.
Am Ende gewinne ich das Mikado-Spiel. Aber nur ganz knapp. Das ist Katharina eh nicht mehr so wichtig; sie zeigt mir jetzt ein Bild, das sie gemalt hat. Sehr schön ist es. Gefällt mir sehr gut.
Pia und Karolina erzählen mir von ihren letzten Tagen in der Schule. Sie sind jetzt in der vierten Klasse, nach den Ferien werden sie die Schule wechseln. Oh ja, sie freuen sich darauf, endlich groß zu sein.
Kian kommt nach den Ferien in die zweite Klasse. Auch er fühlt sich groß. Und stark.
"Ich geh jetzt nach Hause!", rufen zwei Jungen und rennen hinaus.
Andere müssen noch warten, bis sie abgeholt werden. Oder gehen hinüber zur Hausaufgabenbetreuung.
Die Mutter meiner Mikado-Spielpartnerin kommt und nickt mir zu. Katharina läuft zu ihr und geht mit ihr hinaus.
"Tschüss!", ruft sie, als sie schon aus der Tür ist.
Tschüss, denke ich. Und schaue dem Mädchen mit dem großen Ranzen hinterher.
Ich hoffe, du wirst ein gutes Leben haben. Ich hoffe es sehr.
Und ein klein wenig hoffe ich auch, dass jemand für mich gehofft hat, als ich so alt war wie du.
Donnerstag, 20. Juni 2013
Der Prozess der Gewalten.
Es regnet schon seit Stunden. Die Wassermassen verwandeln die Straße vor meinem Fenster in einen reißenden Fluss.
Ich blicke nach draußen und sehe die Regentropfen fallen - erleuchtet von Blitzen, die über den Himmel zucken. Sie verwandeln die nächtliche Dunkelheit in eine taghelle Szenerie. Immer wieder.
Der Donner begleitet das Schauspiel. Wie Paukenschläge lässt er Häuser erzittern und die Bewohner mitten in der Nacht aufschrecken.
Niemand soll schlafen. Niemand soll weggucken.
Alle sollen es sehen. Sie sollen sehen, wie ihre Straßen in tosendem Wasser verschwinden. Wie der Regen die Erde wäscht - vom Schweiß des Sommertages, vom Gestank der Menschen, der in allen Gassen hängt. Alles wird weggetrieben - die Lügen des Tages, den Verrat, die Ungerechtigkeiten.
Im verzerrten Licht der Blitze beobachten die Menschen das Schauspiel der Natur. Doch nur die wenigsten interessieren sich dafür. Sie legen sich in ihre Betten und pressen Kissen auf ihre Ohren, um das zornige Grollen des Donners und das wütende Prasseln des Regens zu überhören.
Wir werden angeklagt in dieser Nacht. Aber kaum jemand nimmt an der Verhandlung teil.
Ich blicke nach draußen und sehe die Regentropfen fallen - erleuchtet von Blitzen, die über den Himmel zucken. Sie verwandeln die nächtliche Dunkelheit in eine taghelle Szenerie. Immer wieder.
Der Donner begleitet das Schauspiel. Wie Paukenschläge lässt er Häuser erzittern und die Bewohner mitten in der Nacht aufschrecken.
Niemand soll schlafen. Niemand soll weggucken.
Alle sollen es sehen. Sie sollen sehen, wie ihre Straßen in tosendem Wasser verschwinden. Wie der Regen die Erde wäscht - vom Schweiß des Sommertages, vom Gestank der Menschen, der in allen Gassen hängt. Alles wird weggetrieben - die Lügen des Tages, den Verrat, die Ungerechtigkeiten.
Im verzerrten Licht der Blitze beobachten die Menschen das Schauspiel der Natur. Doch nur die wenigsten interessieren sich dafür. Sie legen sich in ihre Betten und pressen Kissen auf ihre Ohren, um das zornige Grollen des Donners und das wütende Prasseln des Regens zu überhören.
Wir werden angeklagt in dieser Nacht. Aber kaum jemand nimmt an der Verhandlung teil.
Dienstag, 11. Juni 2013
Sonnenschein.
Morgens scheint mir die Sonne aufs Gesicht, wenn ich die Augen öffne. Ich bin todmüde, ich bin sauer auf meinen Wecker, genervt schleppe ich mich ins Bad. Aber ich stoße nirgendwo an, weil alles hell erleuchtet ist. Und darüber bin ich froh.
Ich muss mir nichts überziehen, wenn ich das Haus verlasse, gehe in T-Shirt oder Sweatshirtjacke. Auf dem Weg begegnen mir Menschen, die lachen und die sich auf den Tag freuen. Es ist keine Dunkelheit da, die mich verschlucken könnte. Und darüber bin ich froh.
Lehrer und Schüler blicken während des Unterrichts aus dem Fenster; und keiner stört sich daran. Die Sonne scheint, wir hören Kinderlachen durch das offene Fenster und freuen uns alle gemeinsam auf das Ende der letzten Stunde. Das heute mindestens fünf Minuten früher kommen wird. Darüber bin ich froh.
Ich bin froh über Helligkeit bis spät in die Nacht hinein und den Sonnenaufgang so früh wie nie.
Bin froh über freudiges Strahlen und optimistisches Glück am Tag.
Bin froh über Momente, in denen man draußen sitzen kann, ohne zu erfrieren.
Ich bin froh über dich und mich und unsere Zeit.
Ich muss mir nichts überziehen, wenn ich das Haus verlasse, gehe in T-Shirt oder Sweatshirtjacke. Auf dem Weg begegnen mir Menschen, die lachen und die sich auf den Tag freuen. Es ist keine Dunkelheit da, die mich verschlucken könnte. Und darüber bin ich froh.
Lehrer und Schüler blicken während des Unterrichts aus dem Fenster; und keiner stört sich daran. Die Sonne scheint, wir hören Kinderlachen durch das offene Fenster und freuen uns alle gemeinsam auf das Ende der letzten Stunde. Das heute mindestens fünf Minuten früher kommen wird. Darüber bin ich froh.
Ich bin froh über Helligkeit bis spät in die Nacht hinein und den Sonnenaufgang so früh wie nie.
Bin froh über freudiges Strahlen und optimistisches Glück am Tag.
Bin froh über Momente, in denen man draußen sitzen kann, ohne zu erfrieren.
Ich bin froh über dich und mich und unsere Zeit.
Donnerstag, 6. Juni 2013
Es lässt uns nicht los.
Manchmal setzen wir uns etwas in den Kopf. Und dann kommen wir nicht mehr davon los. Unsere Gedanken kreisen nur noch um das eine; eine Idee krallt sich in unserem Inneren fest.
Alles führt zu diesem einen Punkt zurück. Egal, worüber wir nachdenken, das Ergebnis ist dasselbe. Am Ende steht immer dieser eine Komplex, der das Gehirn nicht mehr loslässt. Wir spüren ihn, seine Existenz geht in unsere über - eine Symbiose von der Herausforderung und uns selbst.
Wir sind eins. Wir sind unser Ziel, wir sind unser Plan. Und wir sind abhängig voneinander. Unser Leben richtet sich nur noch nach dem einen Gedanken; alle unsere Handlungen, unsere Wege haben nur das eine Ziel.
Und die Idee lebt nur mit uns; sterben wir, geht sie unter, erreichen wir sie, löst sie sich auf.
Solange wird sie bleiben - festgekrallt, angeklebt, eingraviert in uns.
Alles führt zu diesem einen Punkt zurück. Egal, worüber wir nachdenken, das Ergebnis ist dasselbe. Am Ende steht immer dieser eine Komplex, der das Gehirn nicht mehr loslässt. Wir spüren ihn, seine Existenz geht in unsere über - eine Symbiose von der Herausforderung und uns selbst.
Wir sind eins. Wir sind unser Ziel, wir sind unser Plan. Und wir sind abhängig voneinander. Unser Leben richtet sich nur noch nach dem einen Gedanken; alle unsere Handlungen, unsere Wege haben nur das eine Ziel.
Und die Idee lebt nur mit uns; sterben wir, geht sie unter, erreichen wir sie, löst sie sich auf.
Solange wird sie bleiben - festgekrallt, angeklebt, eingraviert in uns.
Mittwoch, 5. Juni 2013
Animum debes mutare.
Flucht ist so befreiend. Flucht ist so herausfordernd. Schön.
Und doch so ungewiss und flüchtig. Feige und unkorrekt.
Wir vergessen die Realität und errichten uns Welten mit Schlössern und Burgen. Wir träumen von der großen Liebe, von Prinzen und Traumfrauen, vom ewigen Leben, vom Retter - vom allumfassenden Sinn des Lebens.
Wir ziehen uns in uns selbst zurück. Wir trinken und bestechen die Welt mit realitätsgetreuen Halluzinationen. Wir vergessen und verdrängen, lassen nichts an uns heran.
Und dann nehmen wir die Beine in die Hand und laufen.
Wir laufen davon, rennen durch Berge und Täler, an Flüssen entlang, durch Sturm und Sonnenschein - auf der Suche nach dem Paradies hinter dem Regenbogen.
Wir machen uns was vor und verkaufen uns für blöd. Wir flüchten selbst vor unserer Flucht. Laufen immer schneller, um den Schatten zu entkommen, die in uns wohnen.
Wir sind zu langsam. Wir flüchten vor der Angst. Doch die reist mit uns.
Und doch so ungewiss und flüchtig. Feige und unkorrekt.
Wir vergessen die Realität und errichten uns Welten mit Schlössern und Burgen. Wir träumen von der großen Liebe, von Prinzen und Traumfrauen, vom ewigen Leben, vom Retter - vom allumfassenden Sinn des Lebens.
Wir ziehen uns in uns selbst zurück. Wir trinken und bestechen die Welt mit realitätsgetreuen Halluzinationen. Wir vergessen und verdrängen, lassen nichts an uns heran.
Und dann nehmen wir die Beine in die Hand und laufen.
Wir laufen davon, rennen durch Berge und Täler, an Flüssen entlang, durch Sturm und Sonnenschein - auf der Suche nach dem Paradies hinter dem Regenbogen.
Wir machen uns was vor und verkaufen uns für blöd. Wir flüchten selbst vor unserer Flucht. Laufen immer schneller, um den Schatten zu entkommen, die in uns wohnen.
Wir sind zu langsam. Wir flüchten vor der Angst. Doch die reist mit uns.
Montag, 3. Juni 2013
Die Seele der Sprache.
Ich bewundere all die Dichter und Denker, die mit ihren Worten ausdrücken, was ich fühle, als hätten sie sich in meinen Kopf gefressen. Als wären sie ein Teil von mir, als lebten sie mein Leben, als seien sie ich selbst.
All die rappenden Gestalten, die in die Welt hinausschreien, was ich denke.
Die altertümlichen Dichter, die Worte für das finden, was ich nicht benennen kann. Die ihr Papier mit Buchstaben füllen und dahinter - eine Fülle von Empfindungen.
Die singenden Propheten, deren Stimmen aus den Lautsprechern tönen, die die Welt verschönern, mit ihrem Gesang.
Melodien zerreißen die Stille, Songtexte füllen die Leere, die in mir ist. Sie erwecken mich zum Leben, indem sie mir zeigen, wer ich bin. Ohne mich zu kennen.
Die Dichter der Altzeit, die Rapper der Neuzeit - sie vollbringen täglich Wunder. Ihre Worte klingen wunderbar, sie bringen Menschen Wunder nah und sie wissen es doch nicht.
Sie denken für sich selbst, dichten für sich selbst, leben für sich selbst.
Wie ähnlich wir uns alle doch sein müssen. Allein deswegen, weil wir alle auf der Suche sind; nach dem passenden Wort im richtigen Vers, dem treffenden Titel für unser Gedicht. Auf der Suche nach Aussagen, nach Wahrheit, nach dem perfekten Zusammenklang von Wort und Emotion.
Und wir finden immer wieder: hinter jedem Buchstaben ein Gefühl, das stärker nicht sein könnte, zwischen jeder Zeile ein Leben, das unausgesprochen bleiben wird.
Und ich zeig dir meine Seele, überwinde Distanzen mit meinen Worten - schwarz auf weiß, was in mir steckt. Unsere Nähe ist greifbar, auch wenn wir uns nicht kennen. Wir lesen einander, gehen tiefer, in intimer Zweisamkeit.
Schreiben ist Atmen; und Lesen mein Puls.
"Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe Unterschied wie zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen."
[Mark Twain]
All die rappenden Gestalten, die in die Welt hinausschreien, was ich denke.
Die altertümlichen Dichter, die Worte für das finden, was ich nicht benennen kann. Die ihr Papier mit Buchstaben füllen und dahinter - eine Fülle von Empfindungen.
Die singenden Propheten, deren Stimmen aus den Lautsprechern tönen, die die Welt verschönern, mit ihrem Gesang.
Melodien zerreißen die Stille, Songtexte füllen die Leere, die in mir ist. Sie erwecken mich zum Leben, indem sie mir zeigen, wer ich bin. Ohne mich zu kennen.
Die Dichter der Altzeit, die Rapper der Neuzeit - sie vollbringen täglich Wunder. Ihre Worte klingen wunderbar, sie bringen Menschen Wunder nah und sie wissen es doch nicht.
Sie denken für sich selbst, dichten für sich selbst, leben für sich selbst.
Wie ähnlich wir uns alle doch sein müssen. Allein deswegen, weil wir alle auf der Suche sind; nach dem passenden Wort im richtigen Vers, dem treffenden Titel für unser Gedicht. Auf der Suche nach Aussagen, nach Wahrheit, nach dem perfekten Zusammenklang von Wort und Emotion.
Und wir finden immer wieder: hinter jedem Buchstaben ein Gefühl, das stärker nicht sein könnte, zwischen jeder Zeile ein Leben, das unausgesprochen bleiben wird.
Und ich zeig dir meine Seele, überwinde Distanzen mit meinen Worten - schwarz auf weiß, was in mir steckt. Unsere Nähe ist greifbar, auch wenn wir uns nicht kennen. Wir lesen einander, gehen tiefer, in intimer Zweisamkeit.
Schreiben ist Atmen; und Lesen mein Puls.
"Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe Unterschied wie zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen."
[Mark Twain]
Abonnieren
Posts (Atom)