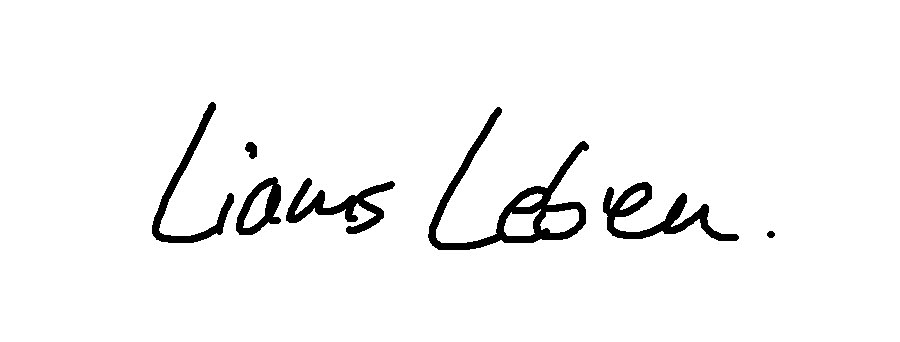Ich träume davon, glücklich zu sein. Zu lachen, strahlend durch die Welt zu laufen, jeden Tag die Marmeladengläser mit Glücksmomenten zu füllen. In jeder Blume die Schönheit der Welt zu erkennen. Auch zu lachen, wenn ich in Scheiße trete. Mich auch über Fehler zu freuen.
Ich träume davon, die Welt zu retten. Und alle Menschen gleich mit. Die Kinder, die Hunger leiden und an Krankheiten sterben, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Die Frauen und Männer und alle, die zu Tode gefoltert werden, die Ungerechtigkeit erleben. Tag für Tag. Und all diejenigen, in deren Leben nur Schmerz ist oder nur Leere oder nur Taubheit.
Ich träume davon, abends die Augen zu schließen und in einen ruhigen Schlaf zu fallen - morgens die Augen zu öffnen, mit einem Lächeln auf dem Gesicht.
Doch wenn ich mich ins Bett lege und versuche, zur Ruhe zu kommen, wenn ich die Lichter ausschalte und mich auf die Suche nach meinen Träumen begebe, dann finden sie nicht den Weg zu mir; nur schwarze Bilder, nur Horrorszenarien, nur Albträume laufen vor meinem inneren Auge ab.
Dabei träume ich doch so viel Schöneres.
Montag, 16. Dezember 2013
Dienstag, 10. Dezember 2013
Schöne Melancholie.
Ich zelebriere die Traurigkeit. Lebe in Melancholie. Und will es so. Irgendwie.
Ich genieße die Einsamkeit, erfreue mich an Depression. Ab und an.
Weil aus ihr so was wie Glück entsteht. So was wie Erleuchtung. Wie Inspiration.
Weil es vielleicht meine Bestimmung ist, melancholisch zu sein.
Ich bin glücklich darüber, traurig zu sein. Vielleicht muss man einfach akzeptieren, dass das geht. Dass Trauer schön sein kann. Dass Depression bereichern kann. Dass Glück nicht immer Jubel ist.
Vielleicht. Ist Leben nicht nur schwarz und weiß.
Ich genieße die Einsamkeit, erfreue mich an Depression. Ab und an.
Weil aus ihr so was wie Glück entsteht. So was wie Erleuchtung. Wie Inspiration.
Weil es vielleicht meine Bestimmung ist, melancholisch zu sein.
Ich bin glücklich darüber, traurig zu sein. Vielleicht muss man einfach akzeptieren, dass das geht. Dass Trauer schön sein kann. Dass Depression bereichern kann. Dass Glück nicht immer Jubel ist.
Vielleicht. Ist Leben nicht nur schwarz und weiß.
Samstag, 7. Dezember 2013
Weihnachts-scheiß-spaziergang.
Ich laufe durch die dunkle Stadt, die gar nicht dunkel ist. Weihnachtssterne leuchten mich an, Lichterketten glänzen vor dem schwarzen Himmel, Weihnachtsmänner strahlen um die Wette.
Der Schnee reflektiert die Lichter der Stadt.
Ich friere, aber es ist gar nicht kalt. Und eigentlich friere ich auch nicht. Bloß meine Hände sind kalt, vielleicht hätte ich doch Handschuhe anziehen sollen. Vielleicht auch nicht, denn eigentlich ist es ja ganz angenehm, wie die Kälte so durch meine Haut kriecht.
Ich halte an, blicke mich um. Keiner da, gut. Keiner sieht mich, gut. Ich beuge mich nach unten, stecke meine Hände in den Schnee. Es ist so kalt, es ist so nass, ich fühle mich. Ich fühle die Welt um mich herum.
Aber sie fühlt mich nicht, sie sieht mich nicht, merkt mich nicht. Mit meinen tauben Fingern forme ich einen Schneeball und schleudere ihn gegen ein Straßenschild. Ich will, dass es ihm wehtut. So wehtut, wie mir. Und ich will schreien, so laut ich kann. Aber ich schreie nicht. Ich blicke mich um, ich schließe die Augen, ich bleibe noch ein paar Minuten stehen und lausche der Stille. Der Stille, die mich umgibt. In die ich mich anpasse. In der ich verschluckt werde.
Meine Hände beginnen zu schmerzen, während mein Blut sie wieder erwärmt. Ich stecke sie in meine Taschen und mache mich wieder auf den Weg. Schritt für Schritt, ich trete in jede Schneewehe, die ich finden kann. Meine Stoffschuhe durchweichen. Gut so. Ich habe sie extra angezogen, ich habe auch keine Winterschuhe, es ist mir auch egal. Sollen sie doch nass werden. Sollen meine Füße doch erfrieren. Sollen sie doch einfach stehen bleiben. Dann friere ich halt hier fest. Mitten auf der Straße.
Ich bleibe wieder stehen und stelle mir vor, wie das wäre. Festgefroren zu sein. Verbunden mit dem Boden, auf alle Zeit. Schaulustige würden ankommen und mich betrachten. Die stärksten Männer der Welt würden kommen und versuchen, mich zu befreien. Autos würden hupen. Vielleicht würden sie mich plattfahren, überfahren, totfahren. Warum eigentlich nicht.
Aber ich hebe meine Beine wieder an, ich setze sie wieder auf, ich gehe rechts, links, rechts, links. Ich werde immer schneller, beginne zu laufen. Durch die taghelle Nacht.
Ich höre Kinder lachen aus einem Haus und ich verlangsame meine Schritte. Ich rieche etwas; etwas, was ich kenne. Was ist das nur, das sind ja Waffeln, frisch gebacken, frisch duftend, gleich werden sie mit Puderzucker bestreut. Ich überlege kurz, ob ich klingeln soll, um zu fragen, ob ich nicht vielleicht mitessen darf oder zumindest zugucken, nichts sagen, nur riechen und gucken und hören und alles in mich aufnehmen. Stiller Beobachter der Vorweihnachtszeit.
Nein danke, ich lass es lieber sein. Und renne weiter, schnell, ehe ich es mir noch anders überlege und mich zum Affen mache, nein danke, nein danke, danke nein.
Ich versuche meine Ohren für den letzten Kilometer zu verschließen. Ich will nicht die Lieder hören, die aus den Häusern dringen, ich will nicht die Kinder hören, die im Garten Schlitten fahren, ich will nicht die lachenden Menschen hören, die gemeinsam um das Lagerfeuer herumstehen. Oder doch, ich will mich dazustellen, ich will mich wärmen, ich will ... weiterrennen.
Und ich stecke den Schlüssel ins Türschloss, meine Finger zittern, sie sind taub. Ich drehe und drehe und hoffe, dass mich keiner meiner Nachbarn beobachtet.
Als ich Tür schließlich öffne, begrüßen mich Dunkelheit und der Fernseher. Ups, hab ich doch glatt vergessen, ihn auszuschalten. Ist auch egal, ist eh alles egal.
Ich drehe den Wasserhahn auf und halte meine roten Finger unter den heißen Strahl. Das Brennen kriecht durch meinen ganzen Körper. Und aus dem Wohnzimmer der Torschrei eines Sky-Moderators, meilenweit entfernt von mir. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich nicht alleine lässt. Trotzdem nervst du mich, du hast ja keine Ahnung, ich schalte dich ab.
Und auf einmal ist es still. Und dunkel. Nein, doch nicht. Der helle Weihnachtsstern der Nachbarn leuchtet durch das Fenster.
Hallo Weihnachtswelt.
Der Schnee reflektiert die Lichter der Stadt.
Ich friere, aber es ist gar nicht kalt. Und eigentlich friere ich auch nicht. Bloß meine Hände sind kalt, vielleicht hätte ich doch Handschuhe anziehen sollen. Vielleicht auch nicht, denn eigentlich ist es ja ganz angenehm, wie die Kälte so durch meine Haut kriecht.
Ich halte an, blicke mich um. Keiner da, gut. Keiner sieht mich, gut. Ich beuge mich nach unten, stecke meine Hände in den Schnee. Es ist so kalt, es ist so nass, ich fühle mich. Ich fühle die Welt um mich herum.
Aber sie fühlt mich nicht, sie sieht mich nicht, merkt mich nicht. Mit meinen tauben Fingern forme ich einen Schneeball und schleudere ihn gegen ein Straßenschild. Ich will, dass es ihm wehtut. So wehtut, wie mir. Und ich will schreien, so laut ich kann. Aber ich schreie nicht. Ich blicke mich um, ich schließe die Augen, ich bleibe noch ein paar Minuten stehen und lausche der Stille. Der Stille, die mich umgibt. In die ich mich anpasse. In der ich verschluckt werde.
Meine Hände beginnen zu schmerzen, während mein Blut sie wieder erwärmt. Ich stecke sie in meine Taschen und mache mich wieder auf den Weg. Schritt für Schritt, ich trete in jede Schneewehe, die ich finden kann. Meine Stoffschuhe durchweichen. Gut so. Ich habe sie extra angezogen, ich habe auch keine Winterschuhe, es ist mir auch egal. Sollen sie doch nass werden. Sollen meine Füße doch erfrieren. Sollen sie doch einfach stehen bleiben. Dann friere ich halt hier fest. Mitten auf der Straße.
Ich bleibe wieder stehen und stelle mir vor, wie das wäre. Festgefroren zu sein. Verbunden mit dem Boden, auf alle Zeit. Schaulustige würden ankommen und mich betrachten. Die stärksten Männer der Welt würden kommen und versuchen, mich zu befreien. Autos würden hupen. Vielleicht würden sie mich plattfahren, überfahren, totfahren. Warum eigentlich nicht.
Aber ich hebe meine Beine wieder an, ich setze sie wieder auf, ich gehe rechts, links, rechts, links. Ich werde immer schneller, beginne zu laufen. Durch die taghelle Nacht.
Ich höre Kinder lachen aus einem Haus und ich verlangsame meine Schritte. Ich rieche etwas; etwas, was ich kenne. Was ist das nur, das sind ja Waffeln, frisch gebacken, frisch duftend, gleich werden sie mit Puderzucker bestreut. Ich überlege kurz, ob ich klingeln soll, um zu fragen, ob ich nicht vielleicht mitessen darf oder zumindest zugucken, nichts sagen, nur riechen und gucken und hören und alles in mich aufnehmen. Stiller Beobachter der Vorweihnachtszeit.
Nein danke, ich lass es lieber sein. Und renne weiter, schnell, ehe ich es mir noch anders überlege und mich zum Affen mache, nein danke, nein danke, danke nein.
Ich versuche meine Ohren für den letzten Kilometer zu verschließen. Ich will nicht die Lieder hören, die aus den Häusern dringen, ich will nicht die Kinder hören, die im Garten Schlitten fahren, ich will nicht die lachenden Menschen hören, die gemeinsam um das Lagerfeuer herumstehen. Oder doch, ich will mich dazustellen, ich will mich wärmen, ich will ... weiterrennen.
Und ich stecke den Schlüssel ins Türschloss, meine Finger zittern, sie sind taub. Ich drehe und drehe und hoffe, dass mich keiner meiner Nachbarn beobachtet.
Als ich Tür schließlich öffne, begrüßen mich Dunkelheit und der Fernseher. Ups, hab ich doch glatt vergessen, ihn auszuschalten. Ist auch egal, ist eh alles egal.
Ich drehe den Wasserhahn auf und halte meine roten Finger unter den heißen Strahl. Das Brennen kriecht durch meinen ganzen Körper. Und aus dem Wohnzimmer der Torschrei eines Sky-Moderators, meilenweit entfernt von mir. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich nicht alleine lässt. Trotzdem nervst du mich, du hast ja keine Ahnung, ich schalte dich ab.
Und auf einmal ist es still. Und dunkel. Nein, doch nicht. Der helle Weihnachtsstern der Nachbarn leuchtet durch das Fenster.
Hallo Weihnachtswelt.
Mittwoch, 20. November 2013
Ja gegen Nein.
Im Kampf mit mir selbst steht
Ja gegen Nein
Geh gegen Bleib
Mach gegen Lass.
In mir sind zwei Seiten. Die eine will Skillet hören, die andere Philipp Poisel. Also springe ich auf YouTube hin und her, zwischen dem einen und dem anderen Lied, der einen und der anderen Band.
Bei ruhigen Liedern fühle ich mich unausgeglichen, will mehr Action, will mehr hören, geht mir alles zu langsam, alles zu sanft, alles zu still.
Bei schnellen Liedern fühle ich mich unverstanden, überfordert mit der Welt, alles geht zu schnell, alles ist zu laut, ich verstehe nichts und höre mich selbst nicht mehr.
Ich kann es mir nicht recht machen. Weil nie beide Seiten glücklich sind.
Und plötzlich stehe ich mit dem Messer in der Hand da, das kalte Metall an meiner nackten Haut. Ich realisiere, wo ich bin; ich realisiere, wer ich bin. Und lege das Messer zurück.
Und hebe das Messer wieder auf. Und dann wieder nicht.
Gut gegen Böse
Glück gegen Pech
Ja gegen Nein.
Ich lege die Klinge in den Schrank und schließe die Tür. Heute gewinnt ein Nein, ein Lass, ein kleines bisschen Glück.
Ein Teil von mir hat gewonnen und versucht zu verdrängen, dass ein anderer Teil verloren hat. Ich drehe Skillet auf und höre nicht auf die Einwände der Gegenseite.
Ein Kampf mit mir selbst ist immer auch ein Kampf gegen mich selbst. Anstrengend. Und ich kann nur verlieren, nur gewinnen.
"And when the scars heal, the pain passes,
As hope burns, we rise from the ashes!
Darkness fades away!
And the light shines on a brave new day!
Our future's here and now,
Here comes the countdown!"
[Skillet]
Ja gegen Nein
Geh gegen Bleib
Mach gegen Lass.
In mir sind zwei Seiten. Die eine will Skillet hören, die andere Philipp Poisel. Also springe ich auf YouTube hin und her, zwischen dem einen und dem anderen Lied, der einen und der anderen Band.
Bei ruhigen Liedern fühle ich mich unausgeglichen, will mehr Action, will mehr hören, geht mir alles zu langsam, alles zu sanft, alles zu still.
Bei schnellen Liedern fühle ich mich unverstanden, überfordert mit der Welt, alles geht zu schnell, alles ist zu laut, ich verstehe nichts und höre mich selbst nicht mehr.
Ich kann es mir nicht recht machen. Weil nie beide Seiten glücklich sind.
Und plötzlich stehe ich mit dem Messer in der Hand da, das kalte Metall an meiner nackten Haut. Ich realisiere, wo ich bin; ich realisiere, wer ich bin. Und lege das Messer zurück.
Und hebe das Messer wieder auf. Und dann wieder nicht.
Gut gegen Böse
Glück gegen Pech
Ja gegen Nein.
Ich lege die Klinge in den Schrank und schließe die Tür. Heute gewinnt ein Nein, ein Lass, ein kleines bisschen Glück.
Ein Teil von mir hat gewonnen und versucht zu verdrängen, dass ein anderer Teil verloren hat. Ich drehe Skillet auf und höre nicht auf die Einwände der Gegenseite.
Ein Kampf mit mir selbst ist immer auch ein Kampf gegen mich selbst. Anstrengend. Und ich kann nur verlieren, nur gewinnen.
"And when the scars heal, the pain passes,
As hope burns, we rise from the ashes!
Darkness fades away!
And the light shines on a brave new day!
Our future's here and now,
Here comes the countdown!"
[Skillet]
Dienstag, 19. November 2013
Wolken beobachten.
Auf dem Gras liegen und den Wolken beim Fliegen zusehen. Bilder erkennen, Tiere entdecken, Gesichter erahnen. Weil aus den weißen Wolkenbergen plötzlich Gestalten werden. In meiner Fantasie, in deiner Fantasie.
Wir liegen nur still da. Reden nicht. Sind nur beisammen, schweigen gemeinsam.
Wir sehen denselben Himmel, liegen auf demselben Boden und blicken in dieselbe Richtung. Trotzdem entdecken wir Unterschiedliches.
Ob du wohl auch den großen Dino siehst, der über den blauen Himmel trabt? Der jetzt seinen Hals reckt, seine Flügel ausstreckt und dann auseinanderfällt, in nichts als weiße Fetzen?
Ob du auch die Hand erkennst, die sich durch die Welt da oben schiebt, die nach allem greift, die Finger streckt und streckt und streckt und dann beim Greifen zerreißt?
Du siehst auch das Herz, was ich sehe. Ganz eindeutig, weiß auf blau. Wir wenden den Blick vom Schauspiel des Himmels, lächeln uns an, ein Kuss. Und die Welt ist wundervoll.
Wir liegen nur still da. Reden nicht. Sind nur beisammen, schweigen gemeinsam.
Wir sehen denselben Himmel, liegen auf demselben Boden und blicken in dieselbe Richtung. Trotzdem entdecken wir Unterschiedliches.
Ob du wohl auch den großen Dino siehst, der über den blauen Himmel trabt? Der jetzt seinen Hals reckt, seine Flügel ausstreckt und dann auseinanderfällt, in nichts als weiße Fetzen?
Ob du auch die Hand erkennst, die sich durch die Welt da oben schiebt, die nach allem greift, die Finger streckt und streckt und streckt und dann beim Greifen zerreißt?
Du siehst auch das Herz, was ich sehe. Ganz eindeutig, weiß auf blau. Wir wenden den Blick vom Schauspiel des Himmels, lächeln uns an, ein Kuss. Und die Welt ist wundervoll.
Mittwoch, 13. November 2013
Zeig mir deine Arme.
Zeig mir, was unter deinen Ärmeln liegt.
Zeig mir deine nackte Haut, zeig mir deine Arme.
Ich höre den Geschichten zu, die deine Narben mir erzählen. Ich fühle den Schmerz mit dir, den du erlebst. Ich kleb dir ein Pflaster auf die Überreste deines Leids. Ich mal dir einen Schmetterling auf die blasse Haut. Der nicht sterben darf. Der leben will, davonfliegen, sich aufmachen, auf den Weg in eine bessere Welt. Auf den Weg bring ich dich.
Ich schreib dir Liebe auf die Arme und reich dir die Hand. Ich halte dich fest, lass dich nicht los. Halte die Finger, die zur Klinge greifen.
Ich schlag mit dir auf Wände ein, wenn die Wut zu stark ist. Ich renne mit dir durch den Regen, wenn der Druck zu groß ist. Ich bleib mit dir liegen, wenn nichts mehr geht. Und zieh dich auf die Beine, wenn du es selbst nicht mehr kannst.
Ich nehm dich in die Arme. Errichte Mauern um dich, ein Bollwerk, eine eigene kleine Burg. In die kein Feind, kein feindliches Gefühl Einzug erhält.
Ich stehe hier und bleibe hier.
Zeig mir deine Arme. Und ich zeig dir meine.
Zeig mir deine nackte Haut, zeig mir deine Arme.
Ich höre den Geschichten zu, die deine Narben mir erzählen. Ich fühle den Schmerz mit dir, den du erlebst. Ich kleb dir ein Pflaster auf die Überreste deines Leids. Ich mal dir einen Schmetterling auf die blasse Haut. Der nicht sterben darf. Der leben will, davonfliegen, sich aufmachen, auf den Weg in eine bessere Welt. Auf den Weg bring ich dich.
Ich schreib dir Liebe auf die Arme und reich dir die Hand. Ich halte dich fest, lass dich nicht los. Halte die Finger, die zur Klinge greifen.
Ich schlag mit dir auf Wände ein, wenn die Wut zu stark ist. Ich renne mit dir durch den Regen, wenn der Druck zu groß ist. Ich bleib mit dir liegen, wenn nichts mehr geht. Und zieh dich auf die Beine, wenn du es selbst nicht mehr kannst.
Ich nehm dich in die Arme. Errichte Mauern um dich, ein Bollwerk, eine eigene kleine Burg. In die kein Feind, kein feindliches Gefühl Einzug erhält.
Ich stehe hier und bleibe hier.
Zeig mir deine Arme. Und ich zeig dir meine.
Sonntag, 10. November 2013
Es brennt in mir.
In mir brennt ein Feuer. Es verzehrt mich, es frisst mich auf, es brennt alles nieder.
Es ist heiß und ich spüre, wie es in mir lodert. Wie es alles angreift, was dort lebt. Wie es meine Organe zu Staub zerlegt. Wie es meine Gefühle in Asche verwandelt. Wie es mich attackiert, von innen heraus.
Ich kann es nicht sehen, ich komme nicht an es heran. Und kann es deswegen nicht löschen. Ich kann nichts retten, kann mich nicht vor den alles verzehrenden Flammen beschützen.
Ich merke, es ist da. Und kann doch nichts tun. Auch wenn ich alles probiere.
Ich versuche, die Flammen zu ersticken. Ich halte die Luft an und atme nicht mehr, damit kein Sauerstoff an den Brandherd gelangt. Aber es bringt nichts. Ich halte es nicht lange genug durch. Wenn ich nach 30 Sekunden wieder nach Luft schnappe, lodert auch das Feuer wieder auf.
Ich versuche, den Brand mit Wasser zu löschen. Ich trinke und trinke, spüle alles runter, damit das Feuer in der Flut erlischt. Es ist nicht möglich. Das, was in mir brennt, ist resistent. Es ist haltbar. Es will nicht sterben. Es will seine lodernden Flammen nicht besiegt wissen. Es will vernichten.
Alles, was in mir ist. Alles, was in mir lebt, will es töten. Das Feuer frisst sich durch mich hindurch. Aber es zeigt sich nicht. Es ist in mir. Es flackert versteckt. Sodass nur ich es spüren kann. Nur ich weiß, es ist da.
In mir brennt ein Feuer. Und trotzdem friere ich.
Es ist nicht wärmend, es spendet kein Leben. Es ist ein kalter Brand. Der nicht gelöscht werden kann, solange ich lebe. Die Flammen ernähren sich von mir.
In mir brennt mein Feuer.
Mittwoch, 6. November 2013
Bruder.
Es ist Schulschluss. Endlich. Ich trabe mit meinen Freunden langsam über den Schulhof. Wir weichen Fünftklässlern aus, die sich über den Platz jagen, Sechstklässlern und ihren Fußbällen, Siebtklässlern, die in kleinen Gruppen zusammenstehen und sich ausgiebig voneinander verabschieden.
Da kommt was Kleines angelaufen. Es boxt mir gegen die Schulter. Es sagt: "Moooin!" und streckt seine Hand zum High Five aus.
Meine Freunde grinsen und ich wende mich dem Kleinen zu. Er beginnt zu erzählen. Von Wettkämpfen und Klassenarbeiten, von seinen Freunden und seinem Wochenende.
Ich höre zu, bleibe still, nicke und ich freue mich.
"Fahren wir zusammen?", fragt er mich auf dem Weg zu den Fahrradständern.
Klar, machen wir. Warum nicht.
Also Tschüss zu meinen Freunden, tschüss zur Schule, schnell dem Kleinen hinterher. Der ist schon meterweit voraus, schließt schon sein Fahrrad auf. Aber er wartet auch gerne auf mich, hat es nicht eilig, grinst mich an, als wir dann endlich starten.
Nebeneinander, durch den grauen November. Er atmet schwer, tritt fleißig in die Pedale, um Schritt zu halten und redet dabei ununterbrochen. Er erzählt mir sein Leben, will in 10 Minuten alles loswerden, was er erlebt.
Ich bin einfach da, fahre meinen Weg, schaue immer mal wieder zu ihm rüber, füge in seine Redepausen ein "cool!" ein "wow!" ein "ja, krass!" ein.
Einige Kreuzungen, Ampeln, Zebrastreifen und ganz viel Erzählen später, trennen sich unsere Wege. Er überquert die Straße und ruft mir zwischen den Autos ein lautes "Tschööö, Bro!" zu und entfernt sich dann, fährt rasend weiter, auf dem Weg zur nächsten Mission.
Tschüss! Schön, dass es dich gibt, kleiner Bruder!
"Sometimes being a brother is even better than being a superhero."
[Marc Brown]
Da kommt was Kleines angelaufen. Es boxt mir gegen die Schulter. Es sagt: "Moooin!" und streckt seine Hand zum High Five aus.
Meine Freunde grinsen und ich wende mich dem Kleinen zu. Er beginnt zu erzählen. Von Wettkämpfen und Klassenarbeiten, von seinen Freunden und seinem Wochenende.
Ich höre zu, bleibe still, nicke und ich freue mich.
"Fahren wir zusammen?", fragt er mich auf dem Weg zu den Fahrradständern.
Klar, machen wir. Warum nicht.
Also Tschüss zu meinen Freunden, tschüss zur Schule, schnell dem Kleinen hinterher. Der ist schon meterweit voraus, schließt schon sein Fahrrad auf. Aber er wartet auch gerne auf mich, hat es nicht eilig, grinst mich an, als wir dann endlich starten.
Nebeneinander, durch den grauen November. Er atmet schwer, tritt fleißig in die Pedale, um Schritt zu halten und redet dabei ununterbrochen. Er erzählt mir sein Leben, will in 10 Minuten alles loswerden, was er erlebt.
Ich bin einfach da, fahre meinen Weg, schaue immer mal wieder zu ihm rüber, füge in seine Redepausen ein "cool!" ein "wow!" ein "ja, krass!" ein.
Einige Kreuzungen, Ampeln, Zebrastreifen und ganz viel Erzählen später, trennen sich unsere Wege. Er überquert die Straße und ruft mir zwischen den Autos ein lautes "Tschööö, Bro!" zu und entfernt sich dann, fährt rasend weiter, auf dem Weg zur nächsten Mission.
Tschüss! Schön, dass es dich gibt, kleiner Bruder!
"Sometimes being a brother is even better than being a superhero."
[Marc Brown]
Freitag, 18. Oktober 2013
Manchmal ist das so.
Manchmal fühle ich mich wie ein Elefant. Schwer und schwerfällig. Meine Arme sind wie aus Beton, meine Beine riesige Tatzen. Ich kann mich nicht bewegen, kann kaum laufen, kann kaum gehen. Dann bleibe ich einfach liegen, groß und grau, ganz allein.
Manchmal fühle ich mich wie eine Feder. Dann fliege ich davon, bin frei, getragen nur vom Hauch des Windes. Ich schwebe dann, zwischen Wolken, zwischen Vögeln, ich bin allein mit mir, aber Einsamkeit verspüre ich nicht.
Manchmal fühle ich mich wie schwarz und manchmal wie weiß; manchmal bin ich eine ganze bunte Farbpalette. Ein Gemisch aus allem, ein Feuerwerk aus tausend Nuancen.
Manchmal bin ich stark und manchmal bin ich schwach.
Manchmal fühle ich mich so richtig verrückt.
Und manchmal denke ich, das ist normal.
Manchmal fühle ich mich wie eine Feder. Dann fliege ich davon, bin frei, getragen nur vom Hauch des Windes. Ich schwebe dann, zwischen Wolken, zwischen Vögeln, ich bin allein mit mir, aber Einsamkeit verspüre ich nicht.
Manchmal fühle ich mich wie schwarz und manchmal wie weiß; manchmal bin ich eine ganze bunte Farbpalette. Ein Gemisch aus allem, ein Feuerwerk aus tausend Nuancen.
Manchmal bin ich stark und manchmal bin ich schwach.
Manchmal fühle ich mich so richtig verrückt.
Und manchmal denke ich, das ist normal.
Montag, 14. Oktober 2013
So verdammt unsichtbar.
Aus dem Nichts taucht er auf. Und ist plötzlich da. Überall, wo ich auch bin. Er kommt mir entgegen, wenn ich zur Schule gehe. Er sitzt auf der Bank in der Stadt, wenn ich zum Einkaufen laufe. Er überquert die Straße, wenn ich aus dem Fenster schaue.
Unvermittelt sehe ich ihn jeden Tag. Und kenne seinen Namen nicht. Weiß nicht, wo er wohnt, woher er kommt; wie er lebt, was er macht. Ich weiß nur: Er ist da.
In seinen beigen Klamotten - weite Jacke, helle Hose, immer einen Beutel dabei. Ich frage mich, was darin ist. Sind es Fotoalben? Das würde passen. Die Einkäufe, die er immer bei sich trägt? Erinnerungen? Sein Leben? Ist es alles, was er hat?
Oft überlege ich, mich neben ihn zu setzen, wenn er alleine auf einer grünen Parkbank sitzt. Mit ihm gemeinsam den Posten zu beziehen, den Tag zu beobachten.
Wen er wohl alles kennt? Was er wohl alles sieht? Er ist das Auge der Stadt, weiß über alles Bescheid. Und man kennt ihn nicht. Ob er Listen führt, darauf wartet, dass ihn jemand anspricht? Dass jemand die Mauer seiner Einsamkeit durchbricht?
Und warum er wohl so plötzlich immer da ist? Ist er unverhofft vereinsamt, seine Frau gestorben, seine Kinder weggezogen? Oder war er vielleicht schon immer da - jeden Tag, mein Leben lang - und ich habe ihn nur nie bemerkt?
Wie viele unsichtbare alte Menschen geistern wohl noch durch die Stadt? Wie viele haben ihren Tarnmantel umgelegt und begegnen mir doch - wie er - jeden Tag? Während ich an der Kasse stehe, an der Ampel warte, wie viele unsichtbare Augen folgen mir? Wohin müsste ich mich wenden, um sie alle zu sehen?
Der alte Mann sitzt heute wieder auf der Bank. Ich schaue ihn an, verlangsame meine Schritte, lächle ihn an und nicke ihm zu. Ich wende meinen Blick nicht von ihm ab. Doch er sieht mich nicht, sieht nur den Boden an. Eingefallen sitzt er da, eingefallen ist sein Leben - vielleicht, ich weiß es nicht. Gar nichts weiß ich.
Und ich gehe weiter, lasse ihn hinter mir. Heute sprechen wir nicht. Heute setze ich mich nicht. Heute kein Gespräch mit ihm.
Vielleicht ja morgen, vielleicht wage ich den Schritt. Vielleicht zeigt er mir dann den Inhalt seiner beigen Tasche, vielleicht erzählt er mir aus seinem Leben? Vielleicht verrät er mir seinen Namen und wir tauschen mehr als nur den einen Blick.
Plötzlich, einige Schritte weiter, außer Sichtweite des alten Herrn, durchzuckt mich ein Gedanke, voller Wucht: Was, wenn er morgen nicht mehr da ist? Wenn ich ihn nicht mehr finde, wenn er den Mantel der Unsichtbarkeit wieder umgelegt hat? Oder gar für immer von hier verschwunden ist, ohne dass ich ihn je gegrüßt habe, dass wir je ein Wort gewechselt hätten?
Ungekannt würde er verschwinden, namenlos ausradiert, ein Unsichtbarer weniger in der vollgelebten Stadt.
Ich würde dich vermissen, alter Mann!
Unvermittelt sehe ich ihn jeden Tag. Und kenne seinen Namen nicht. Weiß nicht, wo er wohnt, woher er kommt; wie er lebt, was er macht. Ich weiß nur: Er ist da.
In seinen beigen Klamotten - weite Jacke, helle Hose, immer einen Beutel dabei. Ich frage mich, was darin ist. Sind es Fotoalben? Das würde passen. Die Einkäufe, die er immer bei sich trägt? Erinnerungen? Sein Leben? Ist es alles, was er hat?
Oft überlege ich, mich neben ihn zu setzen, wenn er alleine auf einer grünen Parkbank sitzt. Mit ihm gemeinsam den Posten zu beziehen, den Tag zu beobachten.
Wen er wohl alles kennt? Was er wohl alles sieht? Er ist das Auge der Stadt, weiß über alles Bescheid. Und man kennt ihn nicht. Ob er Listen führt, darauf wartet, dass ihn jemand anspricht? Dass jemand die Mauer seiner Einsamkeit durchbricht?
Und warum er wohl so plötzlich immer da ist? Ist er unverhofft vereinsamt, seine Frau gestorben, seine Kinder weggezogen? Oder war er vielleicht schon immer da - jeden Tag, mein Leben lang - und ich habe ihn nur nie bemerkt?
Wie viele unsichtbare alte Menschen geistern wohl noch durch die Stadt? Wie viele haben ihren Tarnmantel umgelegt und begegnen mir doch - wie er - jeden Tag? Während ich an der Kasse stehe, an der Ampel warte, wie viele unsichtbare Augen folgen mir? Wohin müsste ich mich wenden, um sie alle zu sehen?
Der alte Mann sitzt heute wieder auf der Bank. Ich schaue ihn an, verlangsame meine Schritte, lächle ihn an und nicke ihm zu. Ich wende meinen Blick nicht von ihm ab. Doch er sieht mich nicht, sieht nur den Boden an. Eingefallen sitzt er da, eingefallen ist sein Leben - vielleicht, ich weiß es nicht. Gar nichts weiß ich.
Und ich gehe weiter, lasse ihn hinter mir. Heute sprechen wir nicht. Heute setze ich mich nicht. Heute kein Gespräch mit ihm.
Vielleicht ja morgen, vielleicht wage ich den Schritt. Vielleicht zeigt er mir dann den Inhalt seiner beigen Tasche, vielleicht erzählt er mir aus seinem Leben? Vielleicht verrät er mir seinen Namen und wir tauschen mehr als nur den einen Blick.
Plötzlich, einige Schritte weiter, außer Sichtweite des alten Herrn, durchzuckt mich ein Gedanke, voller Wucht: Was, wenn er morgen nicht mehr da ist? Wenn ich ihn nicht mehr finde, wenn er den Mantel der Unsichtbarkeit wieder umgelegt hat? Oder gar für immer von hier verschwunden ist, ohne dass ich ihn je gegrüßt habe, dass wir je ein Wort gewechselt hätten?
Ungekannt würde er verschwinden, namenlos ausradiert, ein Unsichtbarer weniger in der vollgelebten Stadt.
Ich würde dich vermissen, alter Mann!
Freitag, 11. Oktober 2013
Kartenhaus.
Ein leichter Windhauch weht. Ich laufe aufgeschreckt hin und her.
Die Karten meines Kartenhauses werden verweht. Alles, was ich aufgebaut habe, wird erschüttert. Alles bricht auseinander, das Gebäude, meine Welt.
Ich versuche zu retten, was zu retten ist. Ich halte Karten fest, drücke sie, ergreife sie.
Doch der Sturm ist zu stark. Alles wankt. Mein Haus, mein Leben, alles wankt. Auch ich wanke im Hurrikan. Die Windhose reißt alles mit sich, der Tornado hinterlässt eine Schneise der Zerstörung.
Mein Haus ist dem Boden gleichgemacht. Ich bin dem Boden gleichgemacht, liege auf der Erde, von Karten zugedeckt. Es ist dunkel, denn die Decke der Überreste lässt kein Licht hindurch.
Ich liege und atme nicht. Liege ganz still, in der Hoffnung, dass niemand mich sieht, dass der Sturm mich niemals mehr findet. Dass er mich liegen und sterben lässt. Hier am Boden.
Doch er tut mir nicht den Gefallen, diesen letzten großen Wunsch. Er kommt zurück und bläst mein gefallenes Leben durcheinander; die Karten fliegen davon, decken mich auf, die Welt kann mich sehen, wie ich hier am Boden liege.
Und auch das Licht kommt zurück. Von bedrohlich aufgetürmten Wolken zwar verdeckt, aber ich kann wieder sehen.
Ich sehe, was um mich herum ist - Nichts.
Ich sehe, dass ich allein bin.
Alles zusammengebrochen.
Nur in den Händen halte ich die Reste meiner Welt.
Pik 10 rechts
Pik Ass links
Der Anfang meines neuen Blatts. Meines Royal Flush. Oder eines neuen Hauses. Der Bau kann beginnen, hier im Nichts.
Die Karten meines Kartenhauses werden verweht. Alles, was ich aufgebaut habe, wird erschüttert. Alles bricht auseinander, das Gebäude, meine Welt.
Ich versuche zu retten, was zu retten ist. Ich halte Karten fest, drücke sie, ergreife sie.
Doch der Sturm ist zu stark. Alles wankt. Mein Haus, mein Leben, alles wankt. Auch ich wanke im Hurrikan. Die Windhose reißt alles mit sich, der Tornado hinterlässt eine Schneise der Zerstörung.
Mein Haus ist dem Boden gleichgemacht. Ich bin dem Boden gleichgemacht, liege auf der Erde, von Karten zugedeckt. Es ist dunkel, denn die Decke der Überreste lässt kein Licht hindurch.
Ich liege und atme nicht. Liege ganz still, in der Hoffnung, dass niemand mich sieht, dass der Sturm mich niemals mehr findet. Dass er mich liegen und sterben lässt. Hier am Boden.
Doch er tut mir nicht den Gefallen, diesen letzten großen Wunsch. Er kommt zurück und bläst mein gefallenes Leben durcheinander; die Karten fliegen davon, decken mich auf, die Welt kann mich sehen, wie ich hier am Boden liege.
Und auch das Licht kommt zurück. Von bedrohlich aufgetürmten Wolken zwar verdeckt, aber ich kann wieder sehen.
Ich sehe, was um mich herum ist - Nichts.
Ich sehe, dass ich allein bin.
Alles zusammengebrochen.
Nur in den Händen halte ich die Reste meiner Welt.
Pik 10 rechts
Pik Ass links
Der Anfang meines neuen Blatts. Meines Royal Flush. Oder eines neuen Hauses. Der Bau kann beginnen, hier im Nichts.
Mittwoch, 2. Oktober 2013
Ins Exil verbannt.
Hier sitze ich nun. In meinem Exil. Mein Herz brennt. Ich stehe in Flammen. In mir lodert ein Feuer, eine Sehnsucht, die
mich verzehrt.
Das kann ich mir nicht verzeihen, ich werde es nie können. Und die Frage, die Frage aller Fragen: Wenn ich es nicht kann, kannst du es dann? Kannst du mir verzeihen? Willst du es?
Darf ich wieder vor dir stehen, auch wenn ich es war, der schuldig ist? Und denkst du an das, was war, bevor ich ging? Weißt du, wo ich jetzt bin?
Ich bin hier, allein mit der Last der Schuld. Ich sitze und warte. Warte darauf, dass ich mir verzeihen kann. Ich warte auf mein Leben. Ich warte darauf, dass ich aus der Verbannung zurückkehren kann, dass meine Strafe abgesessen ist.
Doch das kann sie erst sein, wenn du keinen Schmerz mehr fühlst. Wenn du geheilt bist von den Wunden, die ich dir zugefügt habe, wenn die Narben verblasst sind. Erst dann darf ich gehen. Erst dann bin ich frei. Frei von dir.
Das ist die Schuld des Täters. Die Pflicht des Täters. Das einzige, was ich noch tun kann. Mein einziger, mein ewiger letzter Schritt im Leben mit dir. Ich bin Täter. Ich verachte mich dafür.
Ich will zu dir, ich will die Chancen nutzen, will alles wieder gutmachen, was nicht gutzumachen ist. Mein Herz schmerzt - aber ist das nicht gerecht? Denn ich trage die Schuld.
Meine Dunkelheit, meine Einsamkeit, meine Verbannung, mein Exil.
Ich sitze hier, den Finger auf deinem Namen, die Nachricht eingetippt. Und die Frage ist, kann ich auch damit leben, dass du nein sagst? Dass du mich wegschickst, mich endgültig verbannst, ohne Bewährung dieses Mal? Mir den seidenen Faden zerreißt, an dem meine Verbindung zu dir hängt? Der Faden, der sich Hoffnung nennt.
Kann ich das? Ich glaub, ich kann es nicht.
Also bleibe ich weiter hier, höre unsere alten Lieder und mein Herz zerbricht. Niemand, dem ich die Schuld geben kann, niemand, der die Verantwortung trägt. Außer ich.
Ich habe mich selbst verbannt und vermisse dich jetzt.
Ich kann das Gefühl nicht in Worte fassen,
dabei ist es so leicht. Ich kann nicht beschreiben, was ich sagen will, dabei
ist es doch so klar. Ich vermisse dich.
Auch wenn ich es verbergen kann, auch wenn ich mein Leben lebe und
es nicht den Anschein macht, in mir drin bin ich gefangen, hinter hohe Mauern
gesperrt. Ich verbüße die Strafe, die ich verdiene. Mein Herz auf Ewig in
Dunkelheit verbannt.
Ich habe mich bestraft. Ich habe dich verletzt.Das kann ich mir nicht verzeihen, ich werde es nie können. Und die Frage, die Frage aller Fragen: Wenn ich es nicht kann, kannst du es dann? Kannst du mir verzeihen? Willst du es?
Darf ich wieder vor dir stehen, auch wenn ich es war, der schuldig ist? Und denkst du an das, was war, bevor ich ging? Weißt du, wo ich jetzt bin?
Ich bin hier, allein mit der Last der Schuld. Ich sitze und warte. Warte darauf, dass ich mir verzeihen kann. Ich warte auf mein Leben. Ich warte darauf, dass ich aus der Verbannung zurückkehren kann, dass meine Strafe abgesessen ist.
Doch das kann sie erst sein, wenn du keinen Schmerz mehr fühlst. Wenn du geheilt bist von den Wunden, die ich dir zugefügt habe, wenn die Narben verblasst sind. Erst dann darf ich gehen. Erst dann bin ich frei. Frei von dir.
Das ist die Schuld des Täters. Die Pflicht des Täters. Das einzige, was ich noch tun kann. Mein einziger, mein ewiger letzter Schritt im Leben mit dir. Ich bin Täter. Ich verachte mich dafür.
Ich will zu dir, ich will die Chancen nutzen, will alles wieder gutmachen, was nicht gutzumachen ist. Mein Herz schmerzt - aber ist das nicht gerecht? Denn ich trage die Schuld.
Meine Dunkelheit, meine Einsamkeit, meine Verbannung, mein Exil.
Ich sitze hier, den Finger auf deinem Namen, die Nachricht eingetippt. Und die Frage ist, kann ich auch damit leben, dass du nein sagst? Dass du mich wegschickst, mich endgültig verbannst, ohne Bewährung dieses Mal? Mir den seidenen Faden zerreißt, an dem meine Verbindung zu dir hängt? Der Faden, der sich Hoffnung nennt.
Kann ich das? Ich glaub, ich kann es nicht.
Also bleibe ich weiter hier, höre unsere alten Lieder und mein Herz zerbricht. Niemand, dem ich die Schuld geben kann, niemand, der die Verantwortung trägt. Außer ich.
Ich habe mich selbst verbannt und vermisse dich jetzt.
Dienstag, 17. September 2013
Inspiration gesucht, fliegende Bullen gefunden.
Auf der Suche nach Inspiration bleibe ich wach. Red Bull verleiht Flügel, aber ich fliege nirgendwohin. Ich zwinge mich, auf meinem Stuhl sitzenzubleiben, mein Gesicht zum Schreibtisch zu drehen.
Zwischen Weimarer Republik und Cicero suche ich dich. Und finde dich nicht. Kreativität. Ein kleiner auslösender Funke, ein flackernder Geistesblitz. Ein Gedanke, der sich in mich drängt, der sich in mir festsetzt. Und bleibt. Bis ich ihn in Worte gefasst habe.
Ich suche Inspiration. In der Einsamkeit der Nacht, in der Dunkelheit, in der Stille. Ich höre das Klappern der Tasten, während ich erste Entwürfe verfasse, Ideen revidiere, meinen Kopf auf Papier banne - virtuell, schwarz auf weiß. Und von draußen die Tröten der Deutschen Bahn, immer mal wieder, alle paar Minuten. Irgendjemand arbeitet da draußen jetzt noch, Bauarbeiter. Ich bin nicht allein. Da ist noch jemand wach, noch jemand, der die Nacht zum Tage macht. Gewissermaßen. Irgendwie.
Vielleicht seid ihr es, die mich stört, ihr da draußen, die ihr arbeitet und arbeitet, obwohl ihr schlafen solltet. Weil die Welt jetzt mir gehört. Für ein paar Minuten, für die Zeit zwischen Spät-ins-Bett-Gehern und Frühaufstehern, für die Phase der Dunkelheit, der Endlosigkeit. Melancholie. Die inspiriert.
Aber heute bleibt das schwarze Loch in meinem Hirn schwarz. Wo sonst die Blitze aufflackern, sehe ich nur Dunkelheit. Es bleibt leer, es bleibt löchrig. Und ich öffne die nächste Dose Red Bull, um meine Müdigkeit zu übertönen. Um zu verhindern, dass ich einschlafe, dass ich meine Ideenreichtum-Phase verpasse. Dass die Ideen in meinen Träumen hängenbleiben und verblasst sind, wenn ich morgens aufwache.
Nein, ich bleibe wach. Ich erwarte meinen Geistesblitz.
Die Energy-Drinks benebeln mich, aber sie halten mich wach. Nein, eigentlich passiert rein gar nichts, aber der Placebo-Effekt ist gut. Ich habe das Gefühl, den Schlaf besiegen zu können, Seite an Seite mit Taurin und Guarana, fliegenden Bullen und metallenen Dosen.
Meine Gedanken werden verquerer, springen hin und herer, werden bescheuerter. Meine Augen werden schwerer, mir wird kälter, mein Bett scheint nach mir zu rufen. Während mein Körper dafür kämpft, endlich schlafen zu gehen, nähert sich in meinem Kopf die Phase vollkommener Inspiration. Schalte dich ruhig aus, Körper, ich brauche dich jetzt nicht mehr, erhol dich gut! Das Kommando übernimmt der Geist. Die Fantasie. Poesie.
Schläfriger Ideenreichtum.
Spätestens morgen Früh hasse ich mich dafür. Was soll's! Die nächsten Stunden gehören mir.
Als kreative Anregung für einen Latein-Vortrag gedacht. Hat leider nichts mit dem Thema zu tun. Sollte meine Inspiration wohl auf andere Dinge konzentrieren, Quintilian, pipapo.
Zwischen Weimarer Republik und Cicero suche ich dich. Und finde dich nicht. Kreativität. Ein kleiner auslösender Funke, ein flackernder Geistesblitz. Ein Gedanke, der sich in mich drängt, der sich in mir festsetzt. Und bleibt. Bis ich ihn in Worte gefasst habe.
Ich suche Inspiration. In der Einsamkeit der Nacht, in der Dunkelheit, in der Stille. Ich höre das Klappern der Tasten, während ich erste Entwürfe verfasse, Ideen revidiere, meinen Kopf auf Papier banne - virtuell, schwarz auf weiß. Und von draußen die Tröten der Deutschen Bahn, immer mal wieder, alle paar Minuten. Irgendjemand arbeitet da draußen jetzt noch, Bauarbeiter. Ich bin nicht allein. Da ist noch jemand wach, noch jemand, der die Nacht zum Tage macht. Gewissermaßen. Irgendwie.
Vielleicht seid ihr es, die mich stört, ihr da draußen, die ihr arbeitet und arbeitet, obwohl ihr schlafen solltet. Weil die Welt jetzt mir gehört. Für ein paar Minuten, für die Zeit zwischen Spät-ins-Bett-Gehern und Frühaufstehern, für die Phase der Dunkelheit, der Endlosigkeit. Melancholie. Die inspiriert.
Aber heute bleibt das schwarze Loch in meinem Hirn schwarz. Wo sonst die Blitze aufflackern, sehe ich nur Dunkelheit. Es bleibt leer, es bleibt löchrig. Und ich öffne die nächste Dose Red Bull, um meine Müdigkeit zu übertönen. Um zu verhindern, dass ich einschlafe, dass ich meine Ideenreichtum-Phase verpasse. Dass die Ideen in meinen Träumen hängenbleiben und verblasst sind, wenn ich morgens aufwache.
Nein, ich bleibe wach. Ich erwarte meinen Geistesblitz.
Die Energy-Drinks benebeln mich, aber sie halten mich wach. Nein, eigentlich passiert rein gar nichts, aber der Placebo-Effekt ist gut. Ich habe das Gefühl, den Schlaf besiegen zu können, Seite an Seite mit Taurin und Guarana, fliegenden Bullen und metallenen Dosen.
Meine Gedanken werden verquerer, springen hin und herer, werden bescheuerter. Meine Augen werden schwerer, mir wird kälter, mein Bett scheint nach mir zu rufen. Während mein Körper dafür kämpft, endlich schlafen zu gehen, nähert sich in meinem Kopf die Phase vollkommener Inspiration. Schalte dich ruhig aus, Körper, ich brauche dich jetzt nicht mehr, erhol dich gut! Das Kommando übernimmt der Geist. Die Fantasie. Poesie.
Schläfriger Ideenreichtum.
Spätestens morgen Früh hasse ich mich dafür. Was soll's! Die nächsten Stunden gehören mir.
Als kreative Anregung für einen Latein-Vortrag gedacht. Hat leider nichts mit dem Thema zu tun. Sollte meine Inspiration wohl auf andere Dinge konzentrieren, Quintilian, pipapo.
Montag, 16. September 2013
Der beste Tag deines Lebens.
Ich stehe heute Morgen auf und denke mir: Das wird ein guter Tag! Das wird der beste Tag deines Lebens!
Komme was wolle, ich lass ihn mir nicht nehmen. Komme was wolle, ich will einen schönen Tag! Ich weiß, dass er gut wird, ich weiß es. Weil ich es so will.
Auch wenn es heute regnet, auch wenn ich nass werde; auch wenn es kalt ist, und ich eigentlich Sommer will. Auch wenn ich in Hundekacke trete, mein Schuh jetzt stinkt, auch wenn ich gar keine Lust auf Schule habe und trotzdem hin muss. Shit happens, ich komm drüber weg, weil heute mein Lieblingstag ist. Ich interessiere mich nicht fürs Datum, weiß nicht, warum gerade jetzt; und es ist auch ganz egal.
Ich bin halt einfach aufgewacht und dacht mir: Das kann der beste Tag deines Lebens sein!
Komme was wolle, ich lass ihn mir nicht nehmen. Komme was wolle, ich will einen schönen Tag! Ich weiß, dass er gut wird, ich weiß es. Weil ich es so will.
Auch wenn es heute regnet, auch wenn ich nass werde; auch wenn es kalt ist, und ich eigentlich Sommer will. Auch wenn ich in Hundekacke trete, mein Schuh jetzt stinkt, auch wenn ich gar keine Lust auf Schule habe und trotzdem hin muss. Shit happens, ich komm drüber weg, weil heute mein Lieblingstag ist. Ich interessiere mich nicht fürs Datum, weiß nicht, warum gerade jetzt; und es ist auch ganz egal.
Ich bin halt einfach aufgewacht und dacht mir: Das kann der beste Tag deines Lebens sein!
Mittwoch, 11. September 2013
9/11.
Menschen, die vom Himmel fallen. Körper, die auf die Erde treffen. Lebendig im Moment des Sprunges, mitten im Leben Minuten zuvor. Leblos, wenn sie im Trümmerfeld aufschlagen, wo sich menschliche Überreste mit Metall, mit Papier, mit brennendem Plastik mischen. Tod. Alles ist tot, der ganze Platz ist voller Tod. Krieg. Es sieht aus wie Krieg, niemand hat die Kontrolle.
Menschen, die ihre Hälse in den Himmel recken, die Köpfe in den Nacken legen. Um zu sehen, was passiert. Mehr von dem zu erkennen, was nicht möglich ist. Durch den grauen Rauch schimmert der blaue Himmel und vor ihm lodert der rote Feuerball.
Und immer wieder lösen sich kleine Gestalten aus dem mächtigen Koloss, sie nähern sich der Erde, werden größer und größer, nehmen Form an: Aus winzigen Punkten werden starke Menschen. Menschen, die fallen, fallen - alle beobachten und sind doch wie gelähmt. Sie können nicht verhindern, was vor ihren Augen geschieht, sie können nicht rückgängig machen, was geschah. Sie beobachten nur die verquere Szenerie. Und warten, dass der Fallschirm sich öffnet. Dass der Mensch gebremst zu Boden schwebt.
Aber nichts passiert. Die Zeit tickt weiter, langsam müsste doch ... Alles bleibt verschlossen, kein Schirm spannt sich auf. Wer fällt, fällt weiter - ungebremst.
Einer nach dem anderen blickt nach oben, wo einer nach dem anderen springt. Verfolgt mit den Augen den Weg vom einen und vom anderen, bis er auf den Boden zerschellt. Bis einer nach dem anderen den Blick abwendet. Es ist vorbei. Jede Hilfe kommt zu spät.
Und der ein oder andere fragt sich, was der wohl fühlt da oben, wenn der Boden immer näher kommt, im Bewusstsein, keine Reißleine ziehen zu können, keinen Schritt mehr setzen zu können. Ist es Freiheit? Ist es Glück, aus der brennenden Hölle entkommen zu sein, umgeben nur von Luft, während die Welt zusammenbricht? Ist es Angst vor dem Aufprall? Trauer um den eigenen Tod? Sind die Augen geschlossen oder sind sie aufgerissen?
Seht ihr die Retter, wie sie in die Türme strömen, während ihr unaufhaltsam fallt, fallt, fallt?
Manche Hand in Hand, manche ganz allein. Springen sie. Sterben sie.
Wie viele Welten sterben. An diesem Tag.
Menschen, die ihre Hälse in den Himmel recken, die Köpfe in den Nacken legen. Um zu sehen, was passiert. Mehr von dem zu erkennen, was nicht möglich ist. Durch den grauen Rauch schimmert der blaue Himmel und vor ihm lodert der rote Feuerball.
Und immer wieder lösen sich kleine Gestalten aus dem mächtigen Koloss, sie nähern sich der Erde, werden größer und größer, nehmen Form an: Aus winzigen Punkten werden starke Menschen. Menschen, die fallen, fallen - alle beobachten und sind doch wie gelähmt. Sie können nicht verhindern, was vor ihren Augen geschieht, sie können nicht rückgängig machen, was geschah. Sie beobachten nur die verquere Szenerie. Und warten, dass der Fallschirm sich öffnet. Dass der Mensch gebremst zu Boden schwebt.
Aber nichts passiert. Die Zeit tickt weiter, langsam müsste doch ... Alles bleibt verschlossen, kein Schirm spannt sich auf. Wer fällt, fällt weiter - ungebremst.
Einer nach dem anderen blickt nach oben, wo einer nach dem anderen springt. Verfolgt mit den Augen den Weg vom einen und vom anderen, bis er auf den Boden zerschellt. Bis einer nach dem anderen den Blick abwendet. Es ist vorbei. Jede Hilfe kommt zu spät.
Und der ein oder andere fragt sich, was der wohl fühlt da oben, wenn der Boden immer näher kommt, im Bewusstsein, keine Reißleine ziehen zu können, keinen Schritt mehr setzen zu können. Ist es Freiheit? Ist es Glück, aus der brennenden Hölle entkommen zu sein, umgeben nur von Luft, während die Welt zusammenbricht? Ist es Angst vor dem Aufprall? Trauer um den eigenen Tod? Sind die Augen geschlossen oder sind sie aufgerissen?
Seht ihr die Retter, wie sie in die Türme strömen, während ihr unaufhaltsam fallt, fallt, fallt?
Manche Hand in Hand, manche ganz allein. Springen sie. Sterben sie.
Wie viele Welten sterben. An diesem Tag.
Montag, 9. September 2013
Auf das Leben.
Weil ich manchmal aufblicke und nur Schönes sehe. Wie das Lächeln auf deinem Gesicht. Wie die grünen Blätter der Bäume. Wie die Menschen, die sich mit Regenschirmen durch den Sturm kämpfen.
Weil ich manchmal Musik höre und die Augen schließe. Und sich dann Bilder in meinem Kopf bilden, Töne in meinem Inneren tönen, der Klang durch mich strömt und mich erfüllt - mit Wärme, mit Gefühl.
Weil ich mich manchmal über den Regen ärgere, wie er mich von oben bis unten durchweicht. Und ich dann doch länger stehenbleibe und es genieße, zu fühlen, mich zu spüren, lebendig zu sein.
Weil mir manchmal alles egal ist, was scheiße läuft. Und ich dann vergessen kann, meine Gedanken frei sind, die Ketten des Erinnerns abgelegt - ich nicht nachdenken muss über alles, was war, und alles, was kommt.
Weil ich manchmal stolz bin auf das, was ich bin. Ich manchmal sehe, was ich schon geschafft habe, und mir auf die Schulter klopfe und ein High-Five gebe: "Gut gemacht!", sage ich dann.
Weil ich manchmal einfach so dasitze. Und plötzlich anfange zu lächeln.
Darum lebe ich.
Glücklich
vielleicht
nicht immer,
aber doch
oft genug.
So wie jetzt.
Weil ich manchmal Musik höre und die Augen schließe. Und sich dann Bilder in meinem Kopf bilden, Töne in meinem Inneren tönen, der Klang durch mich strömt und mich erfüllt - mit Wärme, mit Gefühl.
Weil ich mich manchmal über den Regen ärgere, wie er mich von oben bis unten durchweicht. Und ich dann doch länger stehenbleibe und es genieße, zu fühlen, mich zu spüren, lebendig zu sein.
Weil mir manchmal alles egal ist, was scheiße läuft. Und ich dann vergessen kann, meine Gedanken frei sind, die Ketten des Erinnerns abgelegt - ich nicht nachdenken muss über alles, was war, und alles, was kommt.
Weil ich manchmal stolz bin auf das, was ich bin. Ich manchmal sehe, was ich schon geschafft habe, und mir auf die Schulter klopfe und ein High-Five gebe: "Gut gemacht!", sage ich dann.
Weil ich manchmal einfach so dasitze. Und plötzlich anfange zu lächeln.
Darum lebe ich.
Glücklich
vielleicht
nicht immer,
aber doch
oft genug.
So wie jetzt.
Samstag, 31. August 2013
Steine im Weg.
"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen."
[Goethe]
Was aber, wenn die Steine so groß, so schwer sind, dass ich sie nicht heben kann? Wenn mit jedem Brocken, den ich entferne, eine neue Lawine auf mich herabstürzt?
Ich komme nicht weiter, überall ist mir mein Weg versperrt. Ich balanciere über die Geröllbrocken, sammle kleinere Kiesel auf und schmeiße sie beiseite, rolle die großen Felsen an den Straßenrand.
Manchmal denke ich mir auch: "Das reicht!" Dann nehme ich die Trümmer und staple sie zu Türmen, errichte mir Burgen, in denen ich mich eine Zeit lang verkriechen kann, Leben genießen kann. Ich konstruiere Denkmäler am Wegesrand, die für immer an meinen Kampf erinnern werden.
Aber dann muss ich weiter, ich muss weiter und die neue Lawine ergießt sich schon über meine Route. Ich habe keine Kraft mehr, bin von der letzten Anstrengung noch ganz schwach. Energielos schiebe ich ein paar Brocken zur Seite, dann muss ich mich setzen, muss Rast einlegen, ich kann nicht mehr. Also bleibe ich auf diesem Felstrümmer, verweile hier, unterbreche meine Reise. Vor mir sind nur Steine, nur Steine soweit das Auge reicht.
Über ein freies Wegesstück renne ich. Ich laufe, so schnell ich kann, laufe den fallenden Steinen davon. Doch es ist ausweglos, es ist nicht machbar, keine Chance. Sie zwingen mich in die Knie, ich stolpere über die Unebenheiten der Erde, schlage auf dem Grund auf, die Lawine von oben trifft mich und verschüttet mich unter sich. Ich bin am Boden, lebendig begraben, tonnenschweres Gewicht auf mir.
So viele Steine, ich könnte Luftschlösser aus ihnen errichten. Ich könnte Burgen bauen und Statuen erschaffen.
Was aber, wenn ich gar nichts bauen möchte, sondern einfach meinen Weg beschreiten, so geradeaus wie möglich?
[Goethe]
Was aber, wenn die Steine so groß, so schwer sind, dass ich sie nicht heben kann? Wenn mit jedem Brocken, den ich entferne, eine neue Lawine auf mich herabstürzt?
Ich komme nicht weiter, überall ist mir mein Weg versperrt. Ich balanciere über die Geröllbrocken, sammle kleinere Kiesel auf und schmeiße sie beiseite, rolle die großen Felsen an den Straßenrand.
Manchmal denke ich mir auch: "Das reicht!" Dann nehme ich die Trümmer und staple sie zu Türmen, errichte mir Burgen, in denen ich mich eine Zeit lang verkriechen kann, Leben genießen kann. Ich konstruiere Denkmäler am Wegesrand, die für immer an meinen Kampf erinnern werden.
Aber dann muss ich weiter, ich muss weiter und die neue Lawine ergießt sich schon über meine Route. Ich habe keine Kraft mehr, bin von der letzten Anstrengung noch ganz schwach. Energielos schiebe ich ein paar Brocken zur Seite, dann muss ich mich setzen, muss Rast einlegen, ich kann nicht mehr. Also bleibe ich auf diesem Felstrümmer, verweile hier, unterbreche meine Reise. Vor mir sind nur Steine, nur Steine soweit das Auge reicht.
Über ein freies Wegesstück renne ich. Ich laufe, so schnell ich kann, laufe den fallenden Steinen davon. Doch es ist ausweglos, es ist nicht machbar, keine Chance. Sie zwingen mich in die Knie, ich stolpere über die Unebenheiten der Erde, schlage auf dem Grund auf, die Lawine von oben trifft mich und verschüttet mich unter sich. Ich bin am Boden, lebendig begraben, tonnenschweres Gewicht auf mir.
So viele Steine, ich könnte Luftschlösser aus ihnen errichten. Ich könnte Burgen bauen und Statuen erschaffen.
Was aber, wenn ich gar nichts bauen möchte, sondern einfach meinen Weg beschreiten, so geradeaus wie möglich?
Samstag, 24. August 2013
Ein gelber Schmetterling.
Unter mir der graue Asphalt. Ich gehe durch die Straßen. Schritt für Schritt. Ich weiß nicht, wohin ich will. Ich weiß nicht, warum ich gehe. Ich wollte einfach nicht mehr drinnen sitzen müssen.
Mein Blick ist auf den Boden gerichtet. Die Platten des Gehwegs liegen unter mir. Aneinandergereiht. Stein an Stein. Grau und grau an grau.
Es ist, als würde alles um mich herum im Nebel versinken. Ich realisiere nichts. Ich denke nichts. In mir ist nichts.
Auf einmal nehme ich eine schnelle Bewegung neben meinem Kopf wahr. Ein Schmetterling, der mir ins Gesicht fliegt, Zentimeter an meiner Wange vorbei. Im Bruchteil einer Sekunde sehe ich ihn. Er ist hellgelb, bewegt seine Flügel auf und ab. Und er ist klein.
Für dieses zierliche Wesen habe ich meinen Blick gehoben. Und er bleibt oben. Weil ich jetzt plötzlich lächeln muss. Weil ich auf einmal das Leben um mich herum wahrnehme.
Ich sehe die Büsche am Wegesrand, höre das Kinderlachen aus den Gärten und rieche den aufgebauten Grill der Nachbarn.
Ich gehe weiter durch die Straßen, biege ab, wechsle die Seiten. Ich weiß immer noch nicht, wohin ich gehe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ankommen kann.
Sonntag, 18. August 2013
Sturmflut.
Ich lache.
Aber das Lachen erreicht meine Augen nicht. Erreicht mein Herz nicht. In mir bleibt es kalt. Und ich friere.
Die Härchen an meinen Armen stellen sich auf. Gänsehaut. Sie wollen eine Fellschicht bilden, die mich schützt. Vor der Kälte, vor dem eisigen Wind.
Aber der weht nicht draußen. Es stürmt in mir. Alles schwankt in mir. Ich schwanke. Das Unwetter breitet sich weiter in meinem Körper aus. Nebelschwaden ziehen in meinen Kopf, hüllen alles in trostloses Grau. Ich kann nicht mehr denken, kann keinen Gedanken mehr fassen. Ich fühle mich so schwer. Schwerfällig.
Und neben mir sitzen meine Freunde und sie lachen. Ich lache mit, ich freue mich mit. Ich höre zu und ich rede, aber ich weiß nicht, was ich sage. Ich weiß nicht, was sie sagen.
"Voll schön, dass es noch so warm ist!"
Ja. In mir stürmt es und es ist kalt.
Der Meeresspiegel in mir steigt. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Alles wird von den tosenden Fluten verschluckt. Mein Leben, meine Gefühle. Alles geht unter, alles versinkt. Hat jemand einen Rettungsring? Kann mir jemand ein Boot schicken?
SOS, ich bin allein auf offenem Meer.
SOS, kein Land in Sicht.
SOS, ich glaub, ich kann nicht schwimmen. Ich glaub, ich weiß nicht mehr, wie das geht.
Ich würde ja schreien, aber da ist nur Wasser. Ich schlucke Wasser, das schmeckt so salzig. Mein Mund ist voll, ich bin unter Wasser, niemand kann mich hören, wenn ich schrei.
Ich muss husten.
"Haha, alles gut?!"
Ja, ja. Hab mich nur verschluckt. Am Bier, am Meer in mir. Hab mich verschluckt an meiner Welt.
Freitag, 9. August 2013
Draußen ist es hell.
"I know you wanna stay in bed, but it's light outside! It's light outside!"
Mein Wecker reißt mich aus meinen Träumen. Ich drehe mich ein paarmal hin und her, schalte ihn aus und bleibe still im Bett liegen.
Es ist früh, ich bin müde, ich habe keine Lust! Also schließe ich meine Augen einfach wieder. Und reiße sie Sekunden später wieder auf, um auf die Uhr zu schauen.
Ich kämpfe mit mir selbst, kämpfe gegen mich. Gegen den Impuls, liegenzubleiben, weiterzuschlafen, an nichts mehr zu denken. Ich wickle mich in meine Decke, gehe in Gedanken den kommenden Schultag durch und werde noch unmotivierter, meine Beine heute aus dem Bett zu schwingen. Der Unterricht wird anstrengend, die Lehrer unorganisiert, das Gelernte unnötig sein. Ein wenig mehr Schlaf würde ganz bestimmt nicht schaden.
Mit offenen Augen gehe ich den Gedanken weiter nach, bis mein Blick auf die geschlossenen Gardinen fällt. Durch den dünnen Stoff scheint das Licht von außen zu mir herein. Ich weiß, dass die Sonne scheint, ohne es zu sehen. Jetzt schon, um sieben Uhr morgens. Ich fühle die Wärme und spüre die Helligkeit.
Ich denke kurz darüber nach, dass die Sonne auch in 3 Stunden noch scheinen wird, setze mich dann doch aufrecht hin und stelle meine Beine auf den Teppichboden.
Beim Öffnen der Vorhänge bin ich froh, heute aufgestanden zu sein.
Mein Wecker reißt mich aus meinen Träumen. Ich drehe mich ein paarmal hin und her, schalte ihn aus und bleibe still im Bett liegen.
Es ist früh, ich bin müde, ich habe keine Lust! Also schließe ich meine Augen einfach wieder. Und reiße sie Sekunden später wieder auf, um auf die Uhr zu schauen.
Ich kämpfe mit mir selbst, kämpfe gegen mich. Gegen den Impuls, liegenzubleiben, weiterzuschlafen, an nichts mehr zu denken. Ich wickle mich in meine Decke, gehe in Gedanken den kommenden Schultag durch und werde noch unmotivierter, meine Beine heute aus dem Bett zu schwingen. Der Unterricht wird anstrengend, die Lehrer unorganisiert, das Gelernte unnötig sein. Ein wenig mehr Schlaf würde ganz bestimmt nicht schaden.
Mit offenen Augen gehe ich den Gedanken weiter nach, bis mein Blick auf die geschlossenen Gardinen fällt. Durch den dünnen Stoff scheint das Licht von außen zu mir herein. Ich weiß, dass die Sonne scheint, ohne es zu sehen. Jetzt schon, um sieben Uhr morgens. Ich fühle die Wärme und spüre die Helligkeit.
Ich denke kurz darüber nach, dass die Sonne auch in 3 Stunden noch scheinen wird, setze mich dann doch aufrecht hin und stelle meine Beine auf den Teppichboden.
Beim Öffnen der Vorhänge bin ich froh, heute aufgestanden zu sein.
Mittwoch, 7. August 2013
Die Post.
Jeden Tag öffne ich den Briefkasten. Ich blicke in seinen schwarzen Schlund und sehe - nichts. Nur gähnende Leere, kein einzelner Brief, keine Karte, nicht mal Werbung. Die Post war noch nicht da. Oder ist heute einfach so vorübergezogen, hat unserem Haus keine Beachtung geschenkt. Nichts zuzustellen.
Oder könnte es etwa sein, dass die Postbotin ihren Beruf nicht ernstnimmt? Einen Fehler gemacht hat? Der Brief in ihrem Auto verlorengegangen ist, unter einen Sitz gerutscht, sich in einem Stapel anderer Sendungen versteckt? Womöglich ist er beim Nachbarn gelandet, aus Versehen.
Alles Mögliche spiele ich in Gedanken durch, alles Unmögliche auch. Aber es bleibt dabei: Keine Post an diesem Tag.
Ein anderer Tag oder ein paar Stunden später und wieder mein gewöhnlicher Blick in den schwarzen Kasten. Heute sehe ich was, heute ist da was, da ist ganz viel. Ich sehe - nicht für mich, nicht für mich, Werbung, keine Ahnung, Postkarte. Oh, wer war denn in Barcelona? Aha, nett, interessant. Aber ansonsten? Nichts!
Ich durchsuche den Stapel erneut. Nicht das, was ich suche. Nicht das, was ich erwarte. Schon wieder.
Ich vergewissere mich noch einmal, nichts im Briefkasten vergessen zu haben, lasse meinen Blick über den Boden schweifen, denn man weiß ja nie, wo kleine leichte Briefe so hinflattern.
Es bleibt dabei: Nicht meine Post an diesem Tag.
Dann werd ich wohl morgen wieder nachgucken.
Oder könnte es etwa sein, dass die Postbotin ihren Beruf nicht ernstnimmt? Einen Fehler gemacht hat? Der Brief in ihrem Auto verlorengegangen ist, unter einen Sitz gerutscht, sich in einem Stapel anderer Sendungen versteckt? Womöglich ist er beim Nachbarn gelandet, aus Versehen.
Alles Mögliche spiele ich in Gedanken durch, alles Unmögliche auch. Aber es bleibt dabei: Keine Post an diesem Tag.
Ein anderer Tag oder ein paar Stunden später und wieder mein gewöhnlicher Blick in den schwarzen Kasten. Heute sehe ich was, heute ist da was, da ist ganz viel. Ich sehe - nicht für mich, nicht für mich, Werbung, keine Ahnung, Postkarte. Oh, wer war denn in Barcelona? Aha, nett, interessant. Aber ansonsten? Nichts!
Ich durchsuche den Stapel erneut. Nicht das, was ich suche. Nicht das, was ich erwarte. Schon wieder.
Ich vergewissere mich noch einmal, nichts im Briefkasten vergessen zu haben, lasse meinen Blick über den Boden schweifen, denn man weiß ja nie, wo kleine leichte Briefe so hinflattern.
Es bleibt dabei: Nicht meine Post an diesem Tag.
Dann werd ich wohl morgen wieder nachgucken.
Sonntag, 4. August 2013
Fahrt auf dem Gedankenkarussell.
Ich sitze auf dem Sofa. Ich sitze nur da und starre vor mich hin. Ich denke an nichts. Ich mache nichts. Ich bin einfach da. Und bewege mich nicht.
Ich versuche, meine Welt anzuhalten. Sie soll einfrieren, ich will alles zum Erstarren bringen. Das wuselige Treiben der großen Stadt, die Menschen um mich herum. Und den aufgeregten Ameisenhaufen in mir, der meinen Bauch bewohnt. Es soll alles ruhig sein. Starr - für nur einen Moment.
Und doch geht es nicht. Mein Kopf fährt Achterbahn, auch wenn mein Körper ruht. Mein Magen findet keine Ruhe, ob ich sitze oder renne. Alles ist rasant. Um mich herum und in mir drin.
Aufgaben drängen sich mir auf, so viel "Du-musst-noch"s und so viel zu tun. Meine Gedanken wollen nicht ruhen, und mit ihnen kann ich es auch nicht.
Ich schalte Musik an. Will meine Gedanken auf die Melodien fokussieren, sie bändigen. Doch egal welches Lied ich höre, sie springen weiter hin und her, arbeiten weiter unentwegt. Nur wenige Sekunden bleibt ein Song, schnell stelle ich weiter und weiter und dann wieder der nächste und der nächste. Selten bleibe ich bis zum Refrain an einem hängen.
Zwischen Linkin Park und Billy Talent begegnet mir plötzlich Bosse, der ruhig auf mich einsingt. Nach seinem Motto probiere ich jetzt, mein Gedankenkarussell zu stoppen.
"Wenn ich meine Augen schließe, will ich kein Problem mehr."
Doch auch mit geschlossenen Augen rast es weiter in meinem Kopf, es rumort in meinem Bauch. Jetzt mischen sich auch noch Bilder dazu, die sich mir in der Dunkelheit aufdrängen.
Also drücke ich auf "weiter" und höre das nächste Lied.
Etwas Schnelles, etwas Lautes, ganz egal von wem. Es ist nicht der Text, der zählt. Aber der Rhythmus leitet meine Gedanken, fliegt so schnell umher wie sie es tun.
Das Karussell in meinem Kopf und der Ameisenhaufen in meinem Bauch fühlen sich von der temporeichen Melodie verstanden. Das ist was zählt, während ich mich aus meiner Starre löse, aufstehe und mich auf meinem Bett zusammenrolle. Die Nacht kann kommen - es ist laut in mir.
Ich versuche, meine Welt anzuhalten. Sie soll einfrieren, ich will alles zum Erstarren bringen. Das wuselige Treiben der großen Stadt, die Menschen um mich herum. Und den aufgeregten Ameisenhaufen in mir, der meinen Bauch bewohnt. Es soll alles ruhig sein. Starr - für nur einen Moment.
Und doch geht es nicht. Mein Kopf fährt Achterbahn, auch wenn mein Körper ruht. Mein Magen findet keine Ruhe, ob ich sitze oder renne. Alles ist rasant. Um mich herum und in mir drin.
Aufgaben drängen sich mir auf, so viel "Du-musst-noch"s und so viel zu tun. Meine Gedanken wollen nicht ruhen, und mit ihnen kann ich es auch nicht.
Ich schalte Musik an. Will meine Gedanken auf die Melodien fokussieren, sie bändigen. Doch egal welches Lied ich höre, sie springen weiter hin und her, arbeiten weiter unentwegt. Nur wenige Sekunden bleibt ein Song, schnell stelle ich weiter und weiter und dann wieder der nächste und der nächste. Selten bleibe ich bis zum Refrain an einem hängen.
Zwischen Linkin Park und Billy Talent begegnet mir plötzlich Bosse, der ruhig auf mich einsingt. Nach seinem Motto probiere ich jetzt, mein Gedankenkarussell zu stoppen.
"Wenn ich meine Augen schließe, will ich kein Problem mehr."
Doch auch mit geschlossenen Augen rast es weiter in meinem Kopf, es rumort in meinem Bauch. Jetzt mischen sich auch noch Bilder dazu, die sich mir in der Dunkelheit aufdrängen.
Also drücke ich auf "weiter" und höre das nächste Lied.
Etwas Schnelles, etwas Lautes, ganz egal von wem. Es ist nicht der Text, der zählt. Aber der Rhythmus leitet meine Gedanken, fliegt so schnell umher wie sie es tun.
Das Karussell in meinem Kopf und der Ameisenhaufen in meinem Bauch fühlen sich von der temporeichen Melodie verstanden. Das ist was zählt, während ich mich aus meiner Starre löse, aufstehe und mich auf meinem Bett zusammenrolle. Die Nacht kann kommen - es ist laut in mir.
Freitag, 2. August 2013
Liam.
"Liam!"
Der Ruf hallt in meinem Kopf wider. Ich höre den Klang meines Namens, wenn ich die Augen schließe. Wenn ich abends im Bett liege. Obwohl ich ganz alleine bin.
Immer wieder ertönt er in meinen Gedanken. Von verschiedenen Menschen ausgesprochen, in ganz verschiedenen Tonlagen und mit ganz unterschiedlichen Gefühlen. Alle möglichen Absichten stecken dahinter.
Ich höre "Liam!" als Aufforderung, "Liam?" als Anrede, "Liam,..." als Beginn einer Rede, einer Ansprache, einem Vortrag an mich.
Ich höre, wie ich gerufen werde. Wie ich um etwas gebeten, gefragt, angesprochen werde - von den Stimmen in meinem Kopf. Sie wollen etwas von mir. Sie wollen mit mir reden, wollen meine Aufmerksamkeit, wollen einen Teil von mir.
Und sie nutzen meinen Namen, meine vier Buchstaben, um mich zu gewinnen. Das Wort, das mich aufzucken lässt. Wodurch ich mich angesprochen fühle. Was immer etwas auslösen wird in mir.
Obwohl es nur eine Bezeichnung ist, ein Titel, eine Aufschrift, mein Etikett. Wahllos gewählt, einer unter tausend, und doch mein Charakter, meine Kennung, der eine für mich.
Mein Name bestimmt mich. Und ich bestimme ihn.
Ich lebe mit ihm. Durch ihn. Er ist ich. Ich bin Liam.
Der Ruf hallt in meinem Kopf wider. Ich höre den Klang meines Namens, wenn ich die Augen schließe. Wenn ich abends im Bett liege. Obwohl ich ganz alleine bin.
Immer wieder ertönt er in meinen Gedanken. Von verschiedenen Menschen ausgesprochen, in ganz verschiedenen Tonlagen und mit ganz unterschiedlichen Gefühlen. Alle möglichen Absichten stecken dahinter.
Ich höre "Liam!" als Aufforderung, "Liam?" als Anrede, "Liam,..." als Beginn einer Rede, einer Ansprache, einem Vortrag an mich.
Ich höre, wie ich gerufen werde. Wie ich um etwas gebeten, gefragt, angesprochen werde - von den Stimmen in meinem Kopf. Sie wollen etwas von mir. Sie wollen mit mir reden, wollen meine Aufmerksamkeit, wollen einen Teil von mir.
Und sie nutzen meinen Namen, meine vier Buchstaben, um mich zu gewinnen. Das Wort, das mich aufzucken lässt. Wodurch ich mich angesprochen fühle. Was immer etwas auslösen wird in mir.
Obwohl es nur eine Bezeichnung ist, ein Titel, eine Aufschrift, mein Etikett. Wahllos gewählt, einer unter tausend, und doch mein Charakter, meine Kennung, der eine für mich.
Mein Name bestimmt mich. Und ich bestimme ihn.
Ich lebe mit ihm. Durch ihn. Er ist ich. Ich bin Liam.
Montag, 29. Juli 2013
Ein Zeugnis.
Ein Blatt voll mit Zahlen. Das zeigt, wer ich bin.
Ein formloser Zettel. Der zeigt, wie viel wert ich bin.
Bloß ein Stück Papier. So schutzlos und nichtig.
Draußen im Regen würde es sich auflösen. Die schwarzen Zahlen würden verschwimmen, wären unlesbar, wären nutzlos. Das weiße Blatt würde untergehen. Es wäre zerstört.
Im Kamin würde sich das weiß in schwarze Asche verwandeln. Das Papier würde brennen, lichterloh. Um dann zu zerfallen, zu nichts als Staub.
Ich könnte es zerreißen, in tausend Stücke teilen. Mit purer Gewalt. Die Fetzen würde ich in den Wind halten, in der Welt verteilen. So klein, nichts wäre mehr lesbar.
Mein armes Zeugnis, es kann sich nicht schützen. Ganz klein und wehrlos, machtlos und schwach. Es ist dem Leben ausgeliefert.
Und doch kann es meins bestimmen.
Ein formloser Zettel. Der zeigt, wie viel wert ich bin.
Bloß ein Stück Papier. So schutzlos und nichtig.
Draußen im Regen würde es sich auflösen. Die schwarzen Zahlen würden verschwimmen, wären unlesbar, wären nutzlos. Das weiße Blatt würde untergehen. Es wäre zerstört.
Im Kamin würde sich das weiß in schwarze Asche verwandeln. Das Papier würde brennen, lichterloh. Um dann zu zerfallen, zu nichts als Staub.
Ich könnte es zerreißen, in tausend Stücke teilen. Mit purer Gewalt. Die Fetzen würde ich in den Wind halten, in der Welt verteilen. So klein, nichts wäre mehr lesbar.
Mein armes Zeugnis, es kann sich nicht schützen. Ganz klein und wehrlos, machtlos und schwach. Es ist dem Leben ausgeliefert.
Und doch kann es meins bestimmen.
Freitag, 12. Juli 2013
Gemeinsam, am Lagerfeuer.
Wir sitzen am Feuer und genießen die warme Luft, die aufsteigt. Sitzend und redend. Gemeinsam. Wir lachen und unterhalten uns, trinken und essen. Das Feuer verscheucht die Kälte der aufkommenden Nacht. Es spendet Licht, als die Sonne hinter den Häusern verschwunden ist. Es hält uns zusammen. In Gemeinsamkeit.
Ich blicke in die Flammen. Wie sie sich durch das Holz fressen und das Papier einäschern. Alles fällt der lodernden Glut zum Opfer. Nichts bleibt mehr, während wir gemütlich Gemeinsamkeit genießen. Nichts bleibt mehr, während unsere Leben vollkommen werden.
Wenn die Feuerbrunst aus ihrem Korb springen würde, sich vergrößern, Brennstoff in unserem Besitz finden - wir wären verloren. Ein Todbringer, den wir hier züchten. Ein Todbringer als Teil der Gemeinsamkeit.
Wir könnten nicht überleben, sind die Schwächeren im direkten Vergleich. Die warmen Flammen halten uns am Leben und vernichten uns. Wenn sie unsere Körper fassen.
Als das Feuer erlischt, wird es kalt und dunkel. Wir lösen unsere Runde auf und erheben uns - gemeinsam. Legen uns in unsere warmen Betten - jeder allein.
Ich blicke in die Flammen. Wie sie sich durch das Holz fressen und das Papier einäschern. Alles fällt der lodernden Glut zum Opfer. Nichts bleibt mehr, während wir gemütlich Gemeinsamkeit genießen. Nichts bleibt mehr, während unsere Leben vollkommen werden.
Wenn die Feuerbrunst aus ihrem Korb springen würde, sich vergrößern, Brennstoff in unserem Besitz finden - wir wären verloren. Ein Todbringer, den wir hier züchten. Ein Todbringer als Teil der Gemeinsamkeit.
Wir könnten nicht überleben, sind die Schwächeren im direkten Vergleich. Die warmen Flammen halten uns am Leben und vernichten uns. Wenn sie unsere Körper fassen.
Als das Feuer erlischt, wird es kalt und dunkel. Wir lösen unsere Runde auf und erheben uns - gemeinsam. Legen uns in unsere warmen Betten - jeder allein.
Montag, 8. Juli 2013
Guten Morgen.
Die Stadt schläft, während die Welt erwacht.
Vögel sind fleißig am Singen, Helligkeit strömt durch die Straßen. Ein Orchester voller zwitschernder Stimmen begrüßt den Morgen. Aus allen Richtungen tönt das Piepsen und Zwitschern; manchmal ein leises Rascheln der Blätter im Wind.
Und sonst ist es still. In den Einkaufsstraßen und in den Wohngebieten, im Zentrum und außerhalb.
Doch es wirkt nicht ausgestorben; es wirkt friedlich.
Es wirkt nicht leer, sondern erfüllend.
Ich atme tief ein. Die Luft des Morgens - unverbraucht und frisch. Noch kalt von der lauen Nacht und doch angenehm. Es duftet nach Blumen, nach Sommer und nach Neubeginn.
Es fühlt sich an wie Leben. Unbegrenzt.
Vögel sind fleißig am Singen, Helligkeit strömt durch die Straßen. Ein Orchester voller zwitschernder Stimmen begrüßt den Morgen. Aus allen Richtungen tönt das Piepsen und Zwitschern; manchmal ein leises Rascheln der Blätter im Wind.
Und sonst ist es still. In den Einkaufsstraßen und in den Wohngebieten, im Zentrum und außerhalb.
Doch es wirkt nicht ausgestorben; es wirkt friedlich.
Es wirkt nicht leer, sondern erfüllend.
Ich atme tief ein. Die Luft des Morgens - unverbraucht und frisch. Noch kalt von der lauen Nacht und doch angenehm. Es duftet nach Blumen, nach Sommer und nach Neubeginn.
Es fühlt sich an wie Leben. Unbegrenzt.
Samstag, 6. Juli 2013
Warum Vögel singen.
Der Himmel ist blau. Durchsetzt von einzelnen Wolken, die aussehen wie Kissen. Strahlend grinst die Sonne von oben herab. Alles ist erleuchtet.
Ich sehe, wie die Erde sich krümmt. Wie kugelig sie wirklich ist.
Sehe Felder, kleine Häuser, Flüsse, Straßen und das Meer. Und noch mehr.
Ich weiß, wie das Leben läuft. Wo das Leben lebt. Aber ich höre nichts. Es ist still wie es nur still sein kann. Es ist einsam wie es nur einsam sein kann. Frei wie nie.
Frei, drei Kilometer von allem entfernt.
Frei, zwischen Himmel und Erde - im Nirgendwo.
Frei, alles zu tun und alles zu sein.
Ja, ich lebe!
Hier oben im unendlich weiten Blau, wo alles so klein und nichtig wirkt. Wo ich so klein und nichtig bin. Wo nur Vögel mir begegnen. Ich lächle ihnen zu, lasse den Blick kilometerweit schweifen. Endlos. Grenzenlos lebe ich.
Nach ein paar Minuten spüre ich wieder Boden unter meinen Füßen. Das feuchte Gras. Die weiche Erde. Und die Geräusche des Alltags prasseln ungebremst auf mich ein. Das entfernte Rauschen der Autobahn, das Kreischen der Möwen, die Stimmen der Menschen, die auf mich zukommen und mir die Hand schütteln.
Gut gemacht. Ja, ich lebe noch!
Ich sehe, wie die Erde sich krümmt. Wie kugelig sie wirklich ist.
Sehe Felder, kleine Häuser, Flüsse, Straßen und das Meer. Und noch mehr.
Ich weiß, wie das Leben läuft. Wo das Leben lebt. Aber ich höre nichts. Es ist still wie es nur still sein kann. Es ist einsam wie es nur einsam sein kann. Frei wie nie.
Frei, drei Kilometer von allem entfernt.
Frei, zwischen Himmel und Erde - im Nirgendwo.
Frei, alles zu tun und alles zu sein.
Ja, ich lebe!
Hier oben im unendlich weiten Blau, wo alles so klein und nichtig wirkt. Wo ich so klein und nichtig bin. Wo nur Vögel mir begegnen. Ich lächle ihnen zu, lasse den Blick kilometerweit schweifen. Endlos. Grenzenlos lebe ich.
Nach ein paar Minuten spüre ich wieder Boden unter meinen Füßen. Das feuchte Gras. Die weiche Erde. Und die Geräusche des Alltags prasseln ungebremst auf mich ein. Das entfernte Rauschen der Autobahn, das Kreischen der Möwen, die Stimmen der Menschen, die auf mich zukommen und mir die Hand schütteln.
Gut gemacht. Ja, ich lebe noch!
Freitag, 28. Juni 2013
Mit schwarzer Tinte.
Es ist, als hätte jemand ein Glas schwarzer Tinte über mir vergossen.
Ein kleiner Tropfen trifft auf meine blasse Haut und verfärbt sie schwarz. Tödlich schwarz. Und dann breitet sich der dunkle Fleck zu allen Seiten aus. Er wird immer größer und größer.
Die Farbe sickert durch mich durch, dringt in mich ein, durchweicht mich. Und höhlt mich dabei von innen aus, leert mich und füllt alles mit eisiger, dunkler Kälte auf.
Ich hebe die Hände und versuche, das Schwarz aufzuwischen, von meinem Körper zu schieben, ich wringe mich aus wie ein nasses Handtuch. Kämpfe gegen die Infektion, die immer mehr von mir befällt.
Ich hole tief Luft, nehme all die Wärme in mir auf, die ich kriegen kann. Wer weiß, wann die schwarze Pest mein Gesicht erreicht, wann meine Lunge nur noch Dunkelheit in sich aufnehmen kann.
Hilflos blicke ich auf meinen Bauch, wo die Schwärze immer durchdringender wird. Übelkeit breitet sich von dort in meinen gesamten Körper aus. Und mit ihr die Kälte, die mir alles Leben raubt.
Eine Träne löst sich aus meinem Augenwinkel und kullert meinen Körper hinunter, geradewegs auf die schwarze Fläche zu. Ob sie wohl stark genug sein wird, die dunkle Tinte zu verdünnen, aufzulösen, wegzuschwemmen?
Ein kleiner Tropfen trifft auf meine blasse Haut und verfärbt sie schwarz. Tödlich schwarz. Und dann breitet sich der dunkle Fleck zu allen Seiten aus. Er wird immer größer und größer.
Die Farbe sickert durch mich durch, dringt in mich ein, durchweicht mich. Und höhlt mich dabei von innen aus, leert mich und füllt alles mit eisiger, dunkler Kälte auf.
Ich hebe die Hände und versuche, das Schwarz aufzuwischen, von meinem Körper zu schieben, ich wringe mich aus wie ein nasses Handtuch. Kämpfe gegen die Infektion, die immer mehr von mir befällt.
Ich hole tief Luft, nehme all die Wärme in mir auf, die ich kriegen kann. Wer weiß, wann die schwarze Pest mein Gesicht erreicht, wann meine Lunge nur noch Dunkelheit in sich aufnehmen kann.
Hilflos blicke ich auf meinen Bauch, wo die Schwärze immer durchdringender wird. Übelkeit breitet sich von dort in meinen gesamten Körper aus. Und mit ihr die Kälte, die mir alles Leben raubt.
Eine Träne löst sich aus meinem Augenwinkel und kullert meinen Körper hinunter, geradewegs auf die schwarze Fläche zu. Ob sie wohl stark genug sein wird, die dunkle Tinte zu verdünnen, aufzulösen, wegzuschwemmen?
Montag, 24. Juni 2013
Rot und grün.
Mein Finger schwebt über dem grünen Kopf. Deine Nummer leuchtet mich vom Display an. Ich merke, wie ich anfange zu schwitzen, wie meine Hand anfängt zu zittern.
Nervös trete ich von einem Fuß auf den anderen. Ich atme tief ein, schließe die Augen. Versuche, mich zu beruhigen.
Doch es funktioniert nicht. Ich bleibe unruhig, aufgekratzt. Ich habe Angst. Mir wird heiß. Ich trete schneller von einem Bein auf das andere.
Das Telefon liegt schwer und heiß in meiner Hand. Ich lasse meinen Arm sinken und lege es auf das Fensterbrett. Hüpfe zweimal, laufe durch mein Zimmer. Von einer Wand zur anderen. Sechs schnelle Schritte. Hin und her. Hüpfe wieder. Schüttele mich. Ich versuche, alles abzuschütteln. All die Anspannung, all die Nervosität, all die Übelkeit, die in mir aufsteigt.
Ich habe das Gefühl, mich übergeben zu müssen und laufe zur Tür. Als meine Hand das kalte Metall der Türklinke berührt, bleibe ich wie angewurzelt stehen.
Ich erstarre. Wie zu Eis erfroren.
Nein.
Ich werde jetzt nicht gehen. Ich werde die Tür nicht öffnen. Ich werde nicht flüchten. Dieses Mal nicht.
Also schlucke ich den bitteren Geschmack in meinem Mund herunter und stelle mich wieder ans Fensterbrett. Nehme den Hörer wieder in die Hand. Spüre wieder den Schweiß auf meinen Händen.
Ich blicke auf deine Nummer. Auf die Knöpfe. Und drücke auf den roten Knopf.
Aus.
Mein Blick schweift aus dem Fenster. Auf die Regentropfen, die leise vom Himmel fallen. Die Bäume, die ruhig im Wind tanzen. Die Häuser der Nachbarn, die wie Felsen in der Brandung stehen. Ich habe das Gefühl, als wären die Fenster Augen, die mich beobachten. Die mich mit bösen Blicken strafen. Ich halte dem nicht stand und wende mich ab.
Jetzt blicke ich auf die Tür. Die verschlossen ist. Und die ich nicht mehr öffnen wollte. Nicht bevor ich dich angerufen habe.
Ich laufe auf sie zu. Auf die braune Wand mit der goldenen Klinke. Vier Schritte. Meine Hand kracht dröhnend gegen das Holz. Vier Schritte zurück. Meine Hand greift das Telefon.
Ich muss es tun und wähle deine Nummer. Erneut. Erneut blickt sie mich auffordernd vom Display an. Ruf mich an! Wähl mich! Sprich mit mir!
Das Zittern breitet sich auf meinen gesamten Körper aus. Ich kann den Hörer kaum mehr halten. Lehne mich gegen das Fensterbrett. Schließe die Augen.
Und reiße sie dann wieder auf. Stampfe mit dem Fuß auf den Boden. Beiße die Zähne zusammen.
Und presse meinen Daumen auf den grünen Knopf.
Tut.
Hoffentlich geht keiner ran.
Tut.
Es ist keiner da.
TUT.
Ich hab's probiert, lege sofort wieder auf.
"Hallo?"
Scheiße.
Nach 3 Minuten und 47 Sekunden drücke ich mit allerletzter Kraft auf den roten Knopf. Ich kann nicht mehr. Meine Beine geben nach. Ich sinke zu Boden. Lege mich hin. Kann nie mehr aufstehen.
All die Anspannung fällt von mir ab. Alles löst sich in Luft auf. Alles schwindet. Und ich schwinde mit.
Ich robbe zu meinem CD-Player und drücke auf Play.
Tell me when I'm gonna live again
Tell me when this fear will end
Tell me when I'm gonna feel inside
Tell me when I'll feel alive
[Skillet]
Nervös trete ich von einem Fuß auf den anderen. Ich atme tief ein, schließe die Augen. Versuche, mich zu beruhigen.
Doch es funktioniert nicht. Ich bleibe unruhig, aufgekratzt. Ich habe Angst. Mir wird heiß. Ich trete schneller von einem Bein auf das andere.
Das Telefon liegt schwer und heiß in meiner Hand. Ich lasse meinen Arm sinken und lege es auf das Fensterbrett. Hüpfe zweimal, laufe durch mein Zimmer. Von einer Wand zur anderen. Sechs schnelle Schritte. Hin und her. Hüpfe wieder. Schüttele mich. Ich versuche, alles abzuschütteln. All die Anspannung, all die Nervosität, all die Übelkeit, die in mir aufsteigt.
Ich habe das Gefühl, mich übergeben zu müssen und laufe zur Tür. Als meine Hand das kalte Metall der Türklinke berührt, bleibe ich wie angewurzelt stehen.
Ich erstarre. Wie zu Eis erfroren.
Nein.
Ich werde jetzt nicht gehen. Ich werde die Tür nicht öffnen. Ich werde nicht flüchten. Dieses Mal nicht.
Also schlucke ich den bitteren Geschmack in meinem Mund herunter und stelle mich wieder ans Fensterbrett. Nehme den Hörer wieder in die Hand. Spüre wieder den Schweiß auf meinen Händen.
Ich blicke auf deine Nummer. Auf die Knöpfe. Und drücke auf den roten Knopf.
Aus.
Mein Blick schweift aus dem Fenster. Auf die Regentropfen, die leise vom Himmel fallen. Die Bäume, die ruhig im Wind tanzen. Die Häuser der Nachbarn, die wie Felsen in der Brandung stehen. Ich habe das Gefühl, als wären die Fenster Augen, die mich beobachten. Die mich mit bösen Blicken strafen. Ich halte dem nicht stand und wende mich ab.
Jetzt blicke ich auf die Tür. Die verschlossen ist. Und die ich nicht mehr öffnen wollte. Nicht bevor ich dich angerufen habe.
Ich laufe auf sie zu. Auf die braune Wand mit der goldenen Klinke. Vier Schritte. Meine Hand kracht dröhnend gegen das Holz. Vier Schritte zurück. Meine Hand greift das Telefon.
Ich muss es tun und wähle deine Nummer. Erneut. Erneut blickt sie mich auffordernd vom Display an. Ruf mich an! Wähl mich! Sprich mit mir!
Das Zittern breitet sich auf meinen gesamten Körper aus. Ich kann den Hörer kaum mehr halten. Lehne mich gegen das Fensterbrett. Schließe die Augen.
Und reiße sie dann wieder auf. Stampfe mit dem Fuß auf den Boden. Beiße die Zähne zusammen.
Und presse meinen Daumen auf den grünen Knopf.
Tut.
Hoffentlich geht keiner ran.
Tut.
Es ist keiner da.
TUT.
Ich hab's probiert, lege sofort wieder auf.
"Hallo?"
Scheiße.
Nach 3 Minuten und 47 Sekunden drücke ich mit allerletzter Kraft auf den roten Knopf. Ich kann nicht mehr. Meine Beine geben nach. Ich sinke zu Boden. Lege mich hin. Kann nie mehr aufstehen.
All die Anspannung fällt von mir ab. Alles löst sich in Luft auf. Alles schwindet. Und ich schwinde mit.
Ich robbe zu meinem CD-Player und drücke auf Play.
Tell me when I'm gonna live again
Tell me when this fear will end
Tell me when I'm gonna feel inside
Tell me when I'll feel alive
[Skillet]
Sonntag, 23. Juni 2013
Aus Angst.
Nein, ich will nicht schlafen.
Aus Angst, dass die Dämonen mich holen.
Aus Angst, dass die Dunkelheit aus Angst Panik macht.
Aus Angst. Wird Panik. Wird meine ganz eigene Phobie.
Aus Angst. Lasse ich die Lichter an. Die große Lampe an der Decke. Die Schreibtischlampe. Der kleine Stern über meinem Bett. Ich erleuchte jeden Winkel in meinem Zimmer. Jeden Winkel in mir.
Ich will keine Schatten, in denen Dämonen sich verstecken. Will keine schwarzen Flecken an den Wänden, die aussehen wie Gestalten.
Will nicht. Allein sein mit mir. Aus Angst vor mir.
Ich bin müde.
Aber ich kann nicht schlafen wollen.
Aus Angst.
Aus Angst, dass die Dämonen mich holen.
Aus Angst, dass die Dunkelheit aus Angst Panik macht.
Aus Angst. Wird Panik. Wird meine ganz eigene Phobie.
Aus Angst. Lasse ich die Lichter an. Die große Lampe an der Decke. Die Schreibtischlampe. Der kleine Stern über meinem Bett. Ich erleuchte jeden Winkel in meinem Zimmer. Jeden Winkel in mir.
Ich will keine Schatten, in denen Dämonen sich verstecken. Will keine schwarzen Flecken an den Wänden, die aussehen wie Gestalten.
Will nicht. Allein sein mit mir. Aus Angst vor mir.
Ich bin müde.
Aber ich kann nicht schlafen wollen.
Aus Angst.
Freitag, 21. Juni 2013
In der Grundschule.
Ich sitze in der Mensa der Grundschule und hake ab, wer da ist.
"Ich heiße Michael Jackson!", ruft einer. Ein anderer ist "Moby Dick".
Sie rangeln und schubsen sich, lachen und brüllen einander an. Eine der Lehrerinnen fordert die Kinder auf, sich ruhig zu verhalten. Ich grinse einen Jungen an, der einen anderen am Arm festhält. Es sieht so aus, als würden sie tanzen. Keiner verhält sich ruhig.
Und ich hake weiter ab.
"Niklas aus der 2a"
"Katharina aus der 1b"
"Ey, Tommi, du bist dran!"
"Ähm.. Tom aus der 1c"
Alle beugen sich zu mir und versuchen, ihre Namen auf der Liste zu finden. Manche zeigen nur darauf, ohne etwas zu sagen.
"Jana?", frage ich nach. "Oder Sarah?"
Nach einer Viertelstunde Ansturm wird es ruhiger. Hinter jeden Namen habe ich mein Häkchen gesetzt. All die Moby Dicks und Michael Jacksons sitzen jetzt an ihren Tischen und essen.
Nur wenige bleiben länger als fünf Minuten, ehe sie aufstehen und die Reste von ihren Tellern beschämt in den Mülleimer schütten. Oder nach einem weiteren Schnitzel fragen. Und sich dann ihre Portion Nachtisch holen.
Heute gibt es Pudding. Und Lollis.
Ich werde aus der Position des Beobachters geholt und darum gebeten, die verschweißte Plastikfolie zu öffnen. Klar mache ich das. Gerne. Ja, Nero helfe ich auch. Aber Sabrina war vorher da.
Die Kinder werden jetzt mutiger, sprechen mich an. Den fremden großen Jungen, der in ihrer Mensa sitzt.
"Wer ist dein Bruder?" Hä? Meine Brüder werdet ihr nicht kennen.
"Wie heißt du?" Liam. "Mein Bruder hat auch einen Freund, der Liam heißt." Schön.
"Wie alt bist du?" 18. "Meine Nachbarin wird jetzt bald ... mhh.. 17!" Oh ok, ganz schön alt.
"Kannst du mir ein Spiel rausholen?" Ja, welches denn? "Spielst du mit mir Mikado?" Klar, kann ich machen.
Also spiele ich jetzt Mikado. Und nebenbei öffne ich weiter Lollis. Und beantworte Scherzfragen. Ron und Sophie lachen sich schlapp, wenn ich die Antworten nicht weiß.
"Möchtest du auch einen Lolli?" Möchte ich nicht, aber ich sage trotzdem ja. Sehr nett. Danke.
"Haha, guck mal! Ich gewinne!" Ja, sieht wohl so aus.
Am Ende gewinne ich das Mikado-Spiel. Aber nur ganz knapp. Das ist Katharina eh nicht mehr so wichtig; sie zeigt mir jetzt ein Bild, das sie gemalt hat. Sehr schön ist es. Gefällt mir sehr gut.
Pia und Karolina erzählen mir von ihren letzten Tagen in der Schule. Sie sind jetzt in der vierten Klasse, nach den Ferien werden sie die Schule wechseln. Oh ja, sie freuen sich darauf, endlich groß zu sein.
Kian kommt nach den Ferien in die zweite Klasse. Auch er fühlt sich groß. Und stark.
"Ich geh jetzt nach Hause!", rufen zwei Jungen und rennen hinaus.
Andere müssen noch warten, bis sie abgeholt werden. Oder gehen hinüber zur Hausaufgabenbetreuung.
Die Mutter meiner Mikado-Spielpartnerin kommt und nickt mir zu. Katharina läuft zu ihr und geht mit ihr hinaus.
"Tschüss!", ruft sie, als sie schon aus der Tür ist.
Tschüss, denke ich. Und schaue dem Mädchen mit dem großen Ranzen hinterher.
Ich hoffe, du wirst ein gutes Leben haben. Ich hoffe es sehr.
Und ein klein wenig hoffe ich auch, dass jemand für mich gehofft hat, als ich so alt war wie du.
"Ich heiße Michael Jackson!", ruft einer. Ein anderer ist "Moby Dick".
Sie rangeln und schubsen sich, lachen und brüllen einander an. Eine der Lehrerinnen fordert die Kinder auf, sich ruhig zu verhalten. Ich grinse einen Jungen an, der einen anderen am Arm festhält. Es sieht so aus, als würden sie tanzen. Keiner verhält sich ruhig.
Und ich hake weiter ab.
"Niklas aus der 2a"
"Katharina aus der 1b"
"Ey, Tommi, du bist dran!"
"Ähm.. Tom aus der 1c"
Alle beugen sich zu mir und versuchen, ihre Namen auf der Liste zu finden. Manche zeigen nur darauf, ohne etwas zu sagen.
"Jana?", frage ich nach. "Oder Sarah?"
Nach einer Viertelstunde Ansturm wird es ruhiger. Hinter jeden Namen habe ich mein Häkchen gesetzt. All die Moby Dicks und Michael Jacksons sitzen jetzt an ihren Tischen und essen.
Nur wenige bleiben länger als fünf Minuten, ehe sie aufstehen und die Reste von ihren Tellern beschämt in den Mülleimer schütten. Oder nach einem weiteren Schnitzel fragen. Und sich dann ihre Portion Nachtisch holen.
Heute gibt es Pudding. Und Lollis.
Ich werde aus der Position des Beobachters geholt und darum gebeten, die verschweißte Plastikfolie zu öffnen. Klar mache ich das. Gerne. Ja, Nero helfe ich auch. Aber Sabrina war vorher da.
Die Kinder werden jetzt mutiger, sprechen mich an. Den fremden großen Jungen, der in ihrer Mensa sitzt.
"Wer ist dein Bruder?" Hä? Meine Brüder werdet ihr nicht kennen.
"Wie heißt du?" Liam. "Mein Bruder hat auch einen Freund, der Liam heißt." Schön.
"Wie alt bist du?" 18. "Meine Nachbarin wird jetzt bald ... mhh.. 17!" Oh ok, ganz schön alt.
"Kannst du mir ein Spiel rausholen?" Ja, welches denn? "Spielst du mit mir Mikado?" Klar, kann ich machen.
Also spiele ich jetzt Mikado. Und nebenbei öffne ich weiter Lollis. Und beantworte Scherzfragen. Ron und Sophie lachen sich schlapp, wenn ich die Antworten nicht weiß.
"Möchtest du auch einen Lolli?" Möchte ich nicht, aber ich sage trotzdem ja. Sehr nett. Danke.
"Haha, guck mal! Ich gewinne!" Ja, sieht wohl so aus.
Am Ende gewinne ich das Mikado-Spiel. Aber nur ganz knapp. Das ist Katharina eh nicht mehr so wichtig; sie zeigt mir jetzt ein Bild, das sie gemalt hat. Sehr schön ist es. Gefällt mir sehr gut.
Pia und Karolina erzählen mir von ihren letzten Tagen in der Schule. Sie sind jetzt in der vierten Klasse, nach den Ferien werden sie die Schule wechseln. Oh ja, sie freuen sich darauf, endlich groß zu sein.
Kian kommt nach den Ferien in die zweite Klasse. Auch er fühlt sich groß. Und stark.
"Ich geh jetzt nach Hause!", rufen zwei Jungen und rennen hinaus.
Andere müssen noch warten, bis sie abgeholt werden. Oder gehen hinüber zur Hausaufgabenbetreuung.
Die Mutter meiner Mikado-Spielpartnerin kommt und nickt mir zu. Katharina läuft zu ihr und geht mit ihr hinaus.
"Tschüss!", ruft sie, als sie schon aus der Tür ist.
Tschüss, denke ich. Und schaue dem Mädchen mit dem großen Ranzen hinterher.
Ich hoffe, du wirst ein gutes Leben haben. Ich hoffe es sehr.
Und ein klein wenig hoffe ich auch, dass jemand für mich gehofft hat, als ich so alt war wie du.
Donnerstag, 20. Juni 2013
Der Prozess der Gewalten.
Es regnet schon seit Stunden. Die Wassermassen verwandeln die Straße vor meinem Fenster in einen reißenden Fluss.
Ich blicke nach draußen und sehe die Regentropfen fallen - erleuchtet von Blitzen, die über den Himmel zucken. Sie verwandeln die nächtliche Dunkelheit in eine taghelle Szenerie. Immer wieder.
Der Donner begleitet das Schauspiel. Wie Paukenschläge lässt er Häuser erzittern und die Bewohner mitten in der Nacht aufschrecken.
Niemand soll schlafen. Niemand soll weggucken.
Alle sollen es sehen. Sie sollen sehen, wie ihre Straßen in tosendem Wasser verschwinden. Wie der Regen die Erde wäscht - vom Schweiß des Sommertages, vom Gestank der Menschen, der in allen Gassen hängt. Alles wird weggetrieben - die Lügen des Tages, den Verrat, die Ungerechtigkeiten.
Im verzerrten Licht der Blitze beobachten die Menschen das Schauspiel der Natur. Doch nur die wenigsten interessieren sich dafür. Sie legen sich in ihre Betten und pressen Kissen auf ihre Ohren, um das zornige Grollen des Donners und das wütende Prasseln des Regens zu überhören.
Wir werden angeklagt in dieser Nacht. Aber kaum jemand nimmt an der Verhandlung teil.
Ich blicke nach draußen und sehe die Regentropfen fallen - erleuchtet von Blitzen, die über den Himmel zucken. Sie verwandeln die nächtliche Dunkelheit in eine taghelle Szenerie. Immer wieder.
Der Donner begleitet das Schauspiel. Wie Paukenschläge lässt er Häuser erzittern und die Bewohner mitten in der Nacht aufschrecken.
Niemand soll schlafen. Niemand soll weggucken.
Alle sollen es sehen. Sie sollen sehen, wie ihre Straßen in tosendem Wasser verschwinden. Wie der Regen die Erde wäscht - vom Schweiß des Sommertages, vom Gestank der Menschen, der in allen Gassen hängt. Alles wird weggetrieben - die Lügen des Tages, den Verrat, die Ungerechtigkeiten.
Im verzerrten Licht der Blitze beobachten die Menschen das Schauspiel der Natur. Doch nur die wenigsten interessieren sich dafür. Sie legen sich in ihre Betten und pressen Kissen auf ihre Ohren, um das zornige Grollen des Donners und das wütende Prasseln des Regens zu überhören.
Wir werden angeklagt in dieser Nacht. Aber kaum jemand nimmt an der Verhandlung teil.
Dienstag, 11. Juni 2013
Sonnenschein.
Morgens scheint mir die Sonne aufs Gesicht, wenn ich die Augen öffne. Ich bin todmüde, ich bin sauer auf meinen Wecker, genervt schleppe ich mich ins Bad. Aber ich stoße nirgendwo an, weil alles hell erleuchtet ist. Und darüber bin ich froh.
Ich muss mir nichts überziehen, wenn ich das Haus verlasse, gehe in T-Shirt oder Sweatshirtjacke. Auf dem Weg begegnen mir Menschen, die lachen und die sich auf den Tag freuen. Es ist keine Dunkelheit da, die mich verschlucken könnte. Und darüber bin ich froh.
Lehrer und Schüler blicken während des Unterrichts aus dem Fenster; und keiner stört sich daran. Die Sonne scheint, wir hören Kinderlachen durch das offene Fenster und freuen uns alle gemeinsam auf das Ende der letzten Stunde. Das heute mindestens fünf Minuten früher kommen wird. Darüber bin ich froh.
Ich bin froh über Helligkeit bis spät in die Nacht hinein und den Sonnenaufgang so früh wie nie.
Bin froh über freudiges Strahlen und optimistisches Glück am Tag.
Bin froh über Momente, in denen man draußen sitzen kann, ohne zu erfrieren.
Ich bin froh über dich und mich und unsere Zeit.
Ich muss mir nichts überziehen, wenn ich das Haus verlasse, gehe in T-Shirt oder Sweatshirtjacke. Auf dem Weg begegnen mir Menschen, die lachen und die sich auf den Tag freuen. Es ist keine Dunkelheit da, die mich verschlucken könnte. Und darüber bin ich froh.
Lehrer und Schüler blicken während des Unterrichts aus dem Fenster; und keiner stört sich daran. Die Sonne scheint, wir hören Kinderlachen durch das offene Fenster und freuen uns alle gemeinsam auf das Ende der letzten Stunde. Das heute mindestens fünf Minuten früher kommen wird. Darüber bin ich froh.
Ich bin froh über Helligkeit bis spät in die Nacht hinein und den Sonnenaufgang so früh wie nie.
Bin froh über freudiges Strahlen und optimistisches Glück am Tag.
Bin froh über Momente, in denen man draußen sitzen kann, ohne zu erfrieren.
Ich bin froh über dich und mich und unsere Zeit.
Donnerstag, 6. Juni 2013
Es lässt uns nicht los.
Manchmal setzen wir uns etwas in den Kopf. Und dann kommen wir nicht mehr davon los. Unsere Gedanken kreisen nur noch um das eine; eine Idee krallt sich in unserem Inneren fest.
Alles führt zu diesem einen Punkt zurück. Egal, worüber wir nachdenken, das Ergebnis ist dasselbe. Am Ende steht immer dieser eine Komplex, der das Gehirn nicht mehr loslässt. Wir spüren ihn, seine Existenz geht in unsere über - eine Symbiose von der Herausforderung und uns selbst.
Wir sind eins. Wir sind unser Ziel, wir sind unser Plan. Und wir sind abhängig voneinander. Unser Leben richtet sich nur noch nach dem einen Gedanken; alle unsere Handlungen, unsere Wege haben nur das eine Ziel.
Und die Idee lebt nur mit uns; sterben wir, geht sie unter, erreichen wir sie, löst sie sich auf.
Solange wird sie bleiben - festgekrallt, angeklebt, eingraviert in uns.
Alles führt zu diesem einen Punkt zurück. Egal, worüber wir nachdenken, das Ergebnis ist dasselbe. Am Ende steht immer dieser eine Komplex, der das Gehirn nicht mehr loslässt. Wir spüren ihn, seine Existenz geht in unsere über - eine Symbiose von der Herausforderung und uns selbst.
Wir sind eins. Wir sind unser Ziel, wir sind unser Plan. Und wir sind abhängig voneinander. Unser Leben richtet sich nur noch nach dem einen Gedanken; alle unsere Handlungen, unsere Wege haben nur das eine Ziel.
Und die Idee lebt nur mit uns; sterben wir, geht sie unter, erreichen wir sie, löst sie sich auf.
Solange wird sie bleiben - festgekrallt, angeklebt, eingraviert in uns.
Mittwoch, 5. Juni 2013
Animum debes mutare.
Flucht ist so befreiend. Flucht ist so herausfordernd. Schön.
Und doch so ungewiss und flüchtig. Feige und unkorrekt.
Wir vergessen die Realität und errichten uns Welten mit Schlössern und Burgen. Wir träumen von der großen Liebe, von Prinzen und Traumfrauen, vom ewigen Leben, vom Retter - vom allumfassenden Sinn des Lebens.
Wir ziehen uns in uns selbst zurück. Wir trinken und bestechen die Welt mit realitätsgetreuen Halluzinationen. Wir vergessen und verdrängen, lassen nichts an uns heran.
Und dann nehmen wir die Beine in die Hand und laufen.
Wir laufen davon, rennen durch Berge und Täler, an Flüssen entlang, durch Sturm und Sonnenschein - auf der Suche nach dem Paradies hinter dem Regenbogen.
Wir machen uns was vor und verkaufen uns für blöd. Wir flüchten selbst vor unserer Flucht. Laufen immer schneller, um den Schatten zu entkommen, die in uns wohnen.
Wir sind zu langsam. Wir flüchten vor der Angst. Doch die reist mit uns.
Und doch so ungewiss und flüchtig. Feige und unkorrekt.
Wir vergessen die Realität und errichten uns Welten mit Schlössern und Burgen. Wir träumen von der großen Liebe, von Prinzen und Traumfrauen, vom ewigen Leben, vom Retter - vom allumfassenden Sinn des Lebens.
Wir ziehen uns in uns selbst zurück. Wir trinken und bestechen die Welt mit realitätsgetreuen Halluzinationen. Wir vergessen und verdrängen, lassen nichts an uns heran.
Und dann nehmen wir die Beine in die Hand und laufen.
Wir laufen davon, rennen durch Berge und Täler, an Flüssen entlang, durch Sturm und Sonnenschein - auf der Suche nach dem Paradies hinter dem Regenbogen.
Wir machen uns was vor und verkaufen uns für blöd. Wir flüchten selbst vor unserer Flucht. Laufen immer schneller, um den Schatten zu entkommen, die in uns wohnen.
Wir sind zu langsam. Wir flüchten vor der Angst. Doch die reist mit uns.
Montag, 3. Juni 2013
Die Seele der Sprache.
Ich bewundere all die Dichter und Denker, die mit ihren Worten ausdrücken, was ich fühle, als hätten sie sich in meinen Kopf gefressen. Als wären sie ein Teil von mir, als lebten sie mein Leben, als seien sie ich selbst.
All die rappenden Gestalten, die in die Welt hinausschreien, was ich denke.
Die altertümlichen Dichter, die Worte für das finden, was ich nicht benennen kann. Die ihr Papier mit Buchstaben füllen und dahinter - eine Fülle von Empfindungen.
Die singenden Propheten, deren Stimmen aus den Lautsprechern tönen, die die Welt verschönern, mit ihrem Gesang.
Melodien zerreißen die Stille, Songtexte füllen die Leere, die in mir ist. Sie erwecken mich zum Leben, indem sie mir zeigen, wer ich bin. Ohne mich zu kennen.
Die Dichter der Altzeit, die Rapper der Neuzeit - sie vollbringen täglich Wunder. Ihre Worte klingen wunderbar, sie bringen Menschen Wunder nah und sie wissen es doch nicht.
Sie denken für sich selbst, dichten für sich selbst, leben für sich selbst.
Wie ähnlich wir uns alle doch sein müssen. Allein deswegen, weil wir alle auf der Suche sind; nach dem passenden Wort im richtigen Vers, dem treffenden Titel für unser Gedicht. Auf der Suche nach Aussagen, nach Wahrheit, nach dem perfekten Zusammenklang von Wort und Emotion.
Und wir finden immer wieder: hinter jedem Buchstaben ein Gefühl, das stärker nicht sein könnte, zwischen jeder Zeile ein Leben, das unausgesprochen bleiben wird.
Und ich zeig dir meine Seele, überwinde Distanzen mit meinen Worten - schwarz auf weiß, was in mir steckt. Unsere Nähe ist greifbar, auch wenn wir uns nicht kennen. Wir lesen einander, gehen tiefer, in intimer Zweisamkeit.
Schreiben ist Atmen; und Lesen mein Puls.
"Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe Unterschied wie zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen."
[Mark Twain]
All die rappenden Gestalten, die in die Welt hinausschreien, was ich denke.
Die altertümlichen Dichter, die Worte für das finden, was ich nicht benennen kann. Die ihr Papier mit Buchstaben füllen und dahinter - eine Fülle von Empfindungen.
Die singenden Propheten, deren Stimmen aus den Lautsprechern tönen, die die Welt verschönern, mit ihrem Gesang.
Melodien zerreißen die Stille, Songtexte füllen die Leere, die in mir ist. Sie erwecken mich zum Leben, indem sie mir zeigen, wer ich bin. Ohne mich zu kennen.
Die Dichter der Altzeit, die Rapper der Neuzeit - sie vollbringen täglich Wunder. Ihre Worte klingen wunderbar, sie bringen Menschen Wunder nah und sie wissen es doch nicht.
Sie denken für sich selbst, dichten für sich selbst, leben für sich selbst.
Wie ähnlich wir uns alle doch sein müssen. Allein deswegen, weil wir alle auf der Suche sind; nach dem passenden Wort im richtigen Vers, dem treffenden Titel für unser Gedicht. Auf der Suche nach Aussagen, nach Wahrheit, nach dem perfekten Zusammenklang von Wort und Emotion.
Und wir finden immer wieder: hinter jedem Buchstaben ein Gefühl, das stärker nicht sein könnte, zwischen jeder Zeile ein Leben, das unausgesprochen bleiben wird.
Und ich zeig dir meine Seele, überwinde Distanzen mit meinen Worten - schwarz auf weiß, was in mir steckt. Unsere Nähe ist greifbar, auch wenn wir uns nicht kennen. Wir lesen einander, gehen tiefer, in intimer Zweisamkeit.
Schreiben ist Atmen; und Lesen mein Puls.
"Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe Unterschied wie zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen."
[Mark Twain]
Donnerstag, 30. Mai 2013
Sinnlose Zahlen und betrunkene Ziffern.
Die Zahlen verschwimmen vor meinen Augen.
Die, die auf meinem Arbeitsblatt stehen, die ich in einen Collegeblock übertrage, die ich addiere, multipliziere, exponiere, jongliere. Die einfach nicht so wollen, wie ich es will. Sie sind aufgereiht - Kästchen für Kästchen, Spalte für Spalte - und gucken mich an. Sie glänzen in kugelschreiberblau oder in druckertintenschwarz. Sie stehen da, einfach so. Sinnlos.
Und die Zahlen auf der Uhr verschwimmen auch. Es wird später und später. Aber ich merke es nicht, realisiere es nicht; die Information dringt nicht zu mir durch - die Ziffern bleiben belanglose Aufreihungen.
Ratsch! Bäm!
Der Lärm zerreißt die Stille. Ich zerreiße das Arbeitsblatt. Ich werfe die Überreste durch mein Zimmer, zerdrücke Schnipsel zu Mathe-Bällen und schleudere sie durch die Gegend.
Die Wut entweicht. Die angestauten Aggressionen gelangen an die Oberfläche, sie übernehmen das Kommando, übernehmen mein Gehirn.
Ich kann nicht mehr klar denken. Doch die Zahlen starren weiter. Sie fordern mich auf, mit ihnen zu rechnen. Und die Uhr tickt weiter. Jede Minute springt die Anzeige um; eine neue Zahl, mit der ich nichts anfangen kann.
Gluck! Gluck!
Bacardi, Wodka, Red Bull. Alles ist egal. Die Uhr tickt weiter, der zerrissene Zettel will weiter gelöst werden.
Ich trinke. Weiß nur noch nicht, warum. Vielleicht, um mich wachzuhalten und meine Mathe-Hausaufgaben zusammenzukleben und auszurechnen. Vielleicht, um einschlafen zu können, ohne Kissen zu zerreißen und vom Zahlenchaos zu träumen.
Ist mir auch egal. Hauptsache, es wirkt.
Die, die auf meinem Arbeitsblatt stehen, die ich in einen Collegeblock übertrage, die ich addiere, multipliziere, exponiere, jongliere. Die einfach nicht so wollen, wie ich es will. Sie sind aufgereiht - Kästchen für Kästchen, Spalte für Spalte - und gucken mich an. Sie glänzen in kugelschreiberblau oder in druckertintenschwarz. Sie stehen da, einfach so. Sinnlos.
Und die Zahlen auf der Uhr verschwimmen auch. Es wird später und später. Aber ich merke es nicht, realisiere es nicht; die Information dringt nicht zu mir durch - die Ziffern bleiben belanglose Aufreihungen.
Ratsch! Bäm!
Der Lärm zerreißt die Stille. Ich zerreiße das Arbeitsblatt. Ich werfe die Überreste durch mein Zimmer, zerdrücke Schnipsel zu Mathe-Bällen und schleudere sie durch die Gegend.
Die Wut entweicht. Die angestauten Aggressionen gelangen an die Oberfläche, sie übernehmen das Kommando, übernehmen mein Gehirn.
Ich kann nicht mehr klar denken. Doch die Zahlen starren weiter. Sie fordern mich auf, mit ihnen zu rechnen. Und die Uhr tickt weiter. Jede Minute springt die Anzeige um; eine neue Zahl, mit der ich nichts anfangen kann.
Gluck! Gluck!
Bacardi, Wodka, Red Bull. Alles ist egal. Die Uhr tickt weiter, der zerrissene Zettel will weiter gelöst werden.
Ich trinke. Weiß nur noch nicht, warum. Vielleicht, um mich wachzuhalten und meine Mathe-Hausaufgaben zusammenzukleben und auszurechnen. Vielleicht, um einschlafen zu können, ohne Kissen zu zerreißen und vom Zahlenchaos zu träumen.
Ist mir auch egal. Hauptsache, es wirkt.
Samstag, 25. Mai 2013
Wir sind die Besten.
Das ganze Leben ist ein Wettkampf. Dauernd wetteifern wir. Dauernd streiten wir, messen wir uns, kämpfen.
Dauernd wollen wir die Besten sehen.
Die beste Fußballmannschaft Europas.
Den besten Film des Jahres.
Die beste Band der Welt.
Alles wird geprüft und gemessen, Kriterien werden festgelegt, Ergebnisse niedergeschrieben. Und am Ende gewinnt nur einer, kein Unentschieden wird anerkannt, der Zweite hat schon verloren, Silber ist nicht gut genug.
Und das, was die Welt macht, wollen wir auch: Wir wollen uns messen. Wir müssen uns messen. Und wir müssen gewinnen, jeden Tag.
Wir müssen Erwartungen erfüllen; die der anderen und die ganz eigenen. Gegen Ängste kämpfen, das Schicksal besiegen. Wir streben nach Erfolg, nach Anerkennung, nach dem Sieg.
Und wir stellen unsere eigenen Wettkämpfe auf, formen eigene Kategorien:
Der Klassenbeste.
Die beste Freundin.
Die beste, die einzig wahre Musik.
Das ganze Leben ist ein Wettkampf.
Wer dauernd kämpft, kann nur verlieren. Die Kunst ist, die Siege mehr zu feiern als über Niederlagen zu weinen.
Dauernd wollen wir die Besten sehen.
Die beste Fußballmannschaft Europas.
Den besten Film des Jahres.
Die beste Band der Welt.
Alles wird geprüft und gemessen, Kriterien werden festgelegt, Ergebnisse niedergeschrieben. Und am Ende gewinnt nur einer, kein Unentschieden wird anerkannt, der Zweite hat schon verloren, Silber ist nicht gut genug.
Und das, was die Welt macht, wollen wir auch: Wir wollen uns messen. Wir müssen uns messen. Und wir müssen gewinnen, jeden Tag.
Wir müssen Erwartungen erfüllen; die der anderen und die ganz eigenen. Gegen Ängste kämpfen, das Schicksal besiegen. Wir streben nach Erfolg, nach Anerkennung, nach dem Sieg.
Und wir stellen unsere eigenen Wettkämpfe auf, formen eigene Kategorien:
Der Klassenbeste.
Die beste Freundin.
Die beste, die einzig wahre Musik.
Das ganze Leben ist ein Wettkampf.
Wer dauernd kämpft, kann nur verlieren. Die Kunst ist, die Siege mehr zu feiern als über Niederlagen zu weinen.
Mittwoch, 22. Mai 2013
Unsere Tränen.
Die Regentropfen fallen in Strömen vom Himmel hinab. Sie wirken wie Tränen; in jedem einzelnen steckt die Trauer eines Menschen. Die Angst. Die Einsamkeit. Der Regen schreit all die unausgesprochenen Gefühle hinaus in die Welt. Schreit sie den Menschen um die Ohren. Denen, die drinnen sitzen, die das Klopfen der Tropfen auf den Dächern hören. Denjenigen, die draußen herumlaufen, die sich mit Schirmen und Jacken vor all dem Leben schützen; die trocken bleiben wollen um jeden Preis. Und auch all jenen, die sich vom Wasser durchweichen lassen, deren Kleidung nass am Körper klebt; die sich nicht verstecken, die im Regen laufen und tanzen; die den Pfützen nicht ausweichen, die den Blick nach oben wenden - dort, wo der Himmel seine Tore öffnet.
Das sind jene, deren Tränen geweint werden. Jene, die wissen, was die Tropfen bedeuten; die wissen, dass es im Leben nicht immer Schutz gibt. Die erfahren haben, dass es Schlimmeres als Regen gibt; dass Nässe auch schön sein kann, weil sie sich so lebendig anfühlt.
Das sind jene, deren Tränen geweint werden. Jene, die wissen, was die Tropfen bedeuten; die wissen, dass es im Leben nicht immer Schutz gibt. Die erfahren haben, dass es Schlimmeres als Regen gibt; dass Nässe auch schön sein kann, weil sie sich so lebendig anfühlt.
Montag, 20. Mai 2013
Was bleibt.
"Bist du heilig, bist du selig?
Glaubst du wirklich, du bist ewig?
Glaubst du wirklich, du bist ewig?
Schau in meine Hand,
das einzige, was bleibt, ist Sand!
Eine handvoll, die der Wind verweht!
Lang kein Denkmal, nur ein Traum, der geht!
Wie beim Baum im Winter fällt das Laub,
zerfällt zu Staub."
[Weto]
Und alles wird nichtig. Mit dem Tod. Oder schon davor.
Alles wird unwichtig, alles wird so banal.
Was du erreicht hast, verschwindet im Nichts. Was du dir aufgebaut hast, wird von anderen abgerissen.
Die Träume, die du gelebt hast, stehen still. Egal, ob sie erfüllt sind oder am Ende nur Illusion waren. Egal, wie lange sie dich begleitet haben, wie viel du dafür gekämpft haben magst. Sie verschwinden im Nichts, verschwinden mit dir, zerfallen zu Staub, weil keiner mehr da ist, der sie träumt. Keiner mehr, der sie braucht; der sie lebt.
Deine Erinnerungen, deine Gedanken, deine Ideen, deine Pläne - alles, was nicht ausgesprochen wurde, vergeht. Geheimnisse, die mit dir begraben werden. Nur noch Stille, die dich umgibt.
Und was bleibt, sind deine Überreste, deine Knochen, die Gebeine.
Und die Erinnerungen an dich. Das, was du hinterlassen hast. Was du weitergegeben hast. Was für andere wesentlich war. Dein Wesen bleibt.
Bis du nicht mehr weitergegeben wirst - in Worten, in Bildern -, bis der letzte Schwall versiegt, der letzte Mensch stirbt, der noch an dich denkt.
Bis dahin - und dann bist du tot. Zu Staub zerfallen. Banal und nichtig.
Freitag, 17. Mai 2013
Wie Grundschüler lachen.
Die Grundschule liegt im Sonnenschein, wie alles heute. Ich fahre mit dem Fahrrad daran vorbei. Gehetzt, zu spät dran, lustlos - ich trete fleißig in die Pedale. Ein leichter Wind weht und bläst die hellen Stimmen der Kinder zu mir herüber. Sie laufen auf dem Schulhof umher, haben offensichtlich Pause. Ich höre Lachen und Kreischen, freudiges Gebrüll und zarte Ausrufe.
Vor meinem inneren Auge laufen Bilder ab wie in einem Kinofilm. Ich sehe Kinder mit Schulranzen auf den Rücken, die viel zu groß scheinen für die kleinen Körper. Mädchen mit geflochtenen Haaren, Jungen, die gemeinsam an der Tischtennisplatte stehen. Ich sehe Lehrer, die dem bunten Treiben zuschauen, ab und an den Kopf schütteln und immer mal wieder die Stimme lauter werden lassen. Kinder, die nach dem letzten Streich Angst vor ihrer Klassenlehrerin haben. Und die trotzdem nichts befürchten müssen.
Ich sehe Unschuld und Naivität, Toleranz und Liebe für die Welt. Und im Hintergrund immer noch dieses Lachen, dieses Leben, dieser wundervolle Spaß.
Der Film in meinem Kopf endet langsam, die Stimmen verlieren sich im Wind. Ich merke, wie ich langsamer geworden bin, wie meine Beine nur noch ganz sanft in die Pedale treten. Ich habe es zwar eilig, aber trotzdem nehme ich mir Zeit. Zeit, die die Kinder auf dem Schulhof noch massenhaft haben und die ich wieder sehen können will.
Vor meinem inneren Auge laufen Bilder ab wie in einem Kinofilm. Ich sehe Kinder mit Schulranzen auf den Rücken, die viel zu groß scheinen für die kleinen Körper. Mädchen mit geflochtenen Haaren, Jungen, die gemeinsam an der Tischtennisplatte stehen. Ich sehe Lehrer, die dem bunten Treiben zuschauen, ab und an den Kopf schütteln und immer mal wieder die Stimme lauter werden lassen. Kinder, die nach dem letzten Streich Angst vor ihrer Klassenlehrerin haben. Und die trotzdem nichts befürchten müssen.
Ich sehe Unschuld und Naivität, Toleranz und Liebe für die Welt. Und im Hintergrund immer noch dieses Lachen, dieses Leben, dieser wundervolle Spaß.
Der Film in meinem Kopf endet langsam, die Stimmen verlieren sich im Wind. Ich merke, wie ich langsamer geworden bin, wie meine Beine nur noch ganz sanft in die Pedale treten. Ich habe es zwar eilig, aber trotzdem nehme ich mir Zeit. Zeit, die die Kinder auf dem Schulhof noch massenhaft haben und die ich wieder sehen können will.
Mittwoch, 15. Mai 2013
Blutlinien.
Mit einem roten Filzer in der Hand wandere ich meinen Arm auf und ab, hin und her. Ich drücke auf; hinterlasse Linien, blutrot. Sie verschwimmen, gehen ineinander über, überlagern sich.
Sie überdecken das Wahre; was war; wahr war.
Das, was darunter liegt. Die Spuren vergangener Tage, Spuren vergangenen Schmerzes.
Verfärben die verblassten Narben erneut in blutrot. Aber keines fließt.
Bis zum nächsten Duschgang. Wenn das Wasser verfärbt von meinem Körper fließt, fließt wie Blut. Wenn das knallende Rot verschwindet, die geraden Linien verblassen, nur noch pinkfarbene Suppe übrig bleibt.
Dann kommt das Darunterliegende zum Vorschein, die rauen Überreste, die holprigen Narben, die Andenken an Vergangenes. An Tage, als es noch keinen Filzstift gab. Tage, an denen Rasierklingen mich durch mein Leben begleitet haben. Als meine Hand Schmerzen hinterließ, Blutlinien nicht abwaschbar waren.
Damals. Und trotzdem hört's nie auf.
Sie überdecken das Wahre; was war; wahr war.
Das, was darunter liegt. Die Spuren vergangener Tage, Spuren vergangenen Schmerzes.
Verfärben die verblassten Narben erneut in blutrot. Aber keines fließt.
Bis zum nächsten Duschgang. Wenn das Wasser verfärbt von meinem Körper fließt, fließt wie Blut. Wenn das knallende Rot verschwindet, die geraden Linien verblassen, nur noch pinkfarbene Suppe übrig bleibt.
Dann kommt das Darunterliegende zum Vorschein, die rauen Überreste, die holprigen Narben, die Andenken an Vergangenes. An Tage, als es noch keinen Filzstift gab. Tage, an denen Rasierklingen mich durch mein Leben begleitet haben. Als meine Hand Schmerzen hinterließ, Blutlinien nicht abwaschbar waren.
Damals. Und trotzdem hört's nie auf.
Sonntag, 12. Mai 2013
Autobahn.
Lichter rasen an mir vorbei
rasendschnell
weiß und rot
rot und weiß
alles verschwimmt, so schnell bin ich
rotundweißweißundrot
Lichter seh ich nur noch als Schimmer
schimmern grell
leuchten hell
ich weiter schnell
keine Konturen, kein Leben
alles zerfließt, zerfliegt
ich fließe durch die Welt
Mein Fuß steht auf dem Gas
steht und bleibt stehen
drückt und drückt fester
ich lockere ihn nicht
den festen Tritt
weiter, weiter, schneller, rasend
den Lichtern hinterher
den Lichtern entgegen
nur schwarz und hell
und dunkel und grell
nur Kontrast, nur der Blick nach vorn
nur ich.
und die nachtschwarze Autobahn
rasendschnell
weiß und rot
rot und weiß
alles verschwimmt, so schnell bin ich
rotundweißweißundrot
Lichter seh ich nur noch als Schimmer
schimmern grell
leuchten hell
ich weiter schnell
keine Konturen, kein Leben
alles zerfließt, zerfliegt
ich fließe durch die Welt
Mein Fuß steht auf dem Gas
steht und bleibt stehen
drückt und drückt fester
ich lockere ihn nicht
den festen Tritt
weiter, weiter, schneller, rasend
den Lichtern hinterher
den Lichtern entgegen
nur schwarz und hell
und dunkel und grell
nur Kontrast, nur der Blick nach vorn
nur ich.
und die nachtschwarze Autobahn
Freitag, 10. Mai 2013
Versteckt.
Ich verkrieche mich, ziehe mich zurück. Suche mir das beste Versteck, das es gibt. Das, wo kein Mensch je hineinkommen wird, niemand mich finden kann, ich für immer einsam bin.
Ich krieche in mich, versinke in mir. Bin doch ganz nah und trotzdem weit entfernt. Niemand wird mich finden, weil niemand mich sucht. Niemand kann mich sehen, weil ich es nicht will.
Nur mein Körper bleibt stehen, nur mein Äußeres lebt. Ich laufe durch die Straßen, gehe durch meinen Alltag, bestehe fort. Und bin trotzdem in meiner ganz eigenen Welt.
Bin einsam, sehe kein Licht - selbstgewählte Pein.
Je mehr Menschen um mich herum, desto weiter treibe ich fort. Desto mehr ziehe ich mich in Einsamkeit zurück. Desto tiefer verstecke ich mich. Mit jedem Wort verschwinde ich mehr, mit jedem lauten Geräusch entferne ich mich, verdrücke ich mich.
Nur wenn ich allein bin, stecke ich meinen Kopf aus meiner Hülle heraus, blicke um mich herum, sehe Licht, sehe Sonnenschein. Ich schaue in die Welt, bin nicht einsam, aber wohl allein.
Der Stacheldraht um mein Gefängnis bleibt. Mauern baue ich, Grenzen ziehe ich. Keiner darf hinein, wo ich am sichersten bin. Keiner darf sich nähern, wenn ich es nicht will. Und ich kann es nicht wollen.
Wünsche mir jemanden, der die Grenzen sprengt, über Mauern springt und die Zäune umgeht. Aber lasse doch niemanden hinein. Nicht in mein Reich, nicht in meine unangetastete Welt, nicht in das Versteck meines Wesens. Nicht in die Seele meiner Selbst.
Ich werde kleiner und kleiner, damit ich mich besser und besser verstecken kann. Damit ich nicht gesehen werde.
Unsichtbar, ein Knäuel nur. Versteckt, verbannt von mir selbst. Auf der Suche nach Sicherheit, eingesperrt, mit Angst vor der Flucht.
Ich krieche in mich, versinke in mir. Bin doch ganz nah und trotzdem weit entfernt. Niemand wird mich finden, weil niemand mich sucht. Niemand kann mich sehen, weil ich es nicht will.
Nur mein Körper bleibt stehen, nur mein Äußeres lebt. Ich laufe durch die Straßen, gehe durch meinen Alltag, bestehe fort. Und bin trotzdem in meiner ganz eigenen Welt.
Bin einsam, sehe kein Licht - selbstgewählte Pein.
Je mehr Menschen um mich herum, desto weiter treibe ich fort. Desto mehr ziehe ich mich in Einsamkeit zurück. Desto tiefer verstecke ich mich. Mit jedem Wort verschwinde ich mehr, mit jedem lauten Geräusch entferne ich mich, verdrücke ich mich.
Nur wenn ich allein bin, stecke ich meinen Kopf aus meiner Hülle heraus, blicke um mich herum, sehe Licht, sehe Sonnenschein. Ich schaue in die Welt, bin nicht einsam, aber wohl allein.
Der Stacheldraht um mein Gefängnis bleibt. Mauern baue ich, Grenzen ziehe ich. Keiner darf hinein, wo ich am sichersten bin. Keiner darf sich nähern, wenn ich es nicht will. Und ich kann es nicht wollen.
Wünsche mir jemanden, der die Grenzen sprengt, über Mauern springt und die Zäune umgeht. Aber lasse doch niemanden hinein. Nicht in mein Reich, nicht in meine unangetastete Welt, nicht in das Versteck meines Wesens. Nicht in die Seele meiner Selbst.
Ich werde kleiner und kleiner, damit ich mich besser und besser verstecken kann. Damit ich nicht gesehen werde.
Unsichtbar, ein Knäuel nur. Versteckt, verbannt von mir selbst. Auf der Suche nach Sicherheit, eingesperrt, mit Angst vor der Flucht.
Mittwoch, 8. Mai 2013
Rennen und regnen.
Ich laufe durch die engen Gassen und der Regen fällt. Er fällt auf mich, trifft mich, durchnässt mich. Ich laufe weiter und weiter und ich werde nasser und nasser.
Mein T-Shirt saugt sich voll, meine Haare tropfen, überall Tropfen. Sie springen auf und ab, hüpfen hin und her; und ich hechte hindurch. Laufe Zickzack und kann doch nicht entkommen, komme nicht davon, kann mich nicht retten, kann nur verlieren - egal bei welchem Spiel. Ich werde getroffen und getroffen und gehe doch nicht zu Boden.
Auch wenn alles mich nach unten zieht. Das Gewicht meines durchnässten Shirts, meiner klitschnassen Hose, alles reißt mich in die Tiefe. Ich werde schwerer und schwerer und schwerer. Ich sinke hinab. Ich falle. Falle. Falle. In der Falle.
So schwer, ich kann mich kaum bewegen. So schwer, ich kann mein Bein nicht mehr heben. So schwer, der Boden bricht unter mir. Und alles bricht ein, es geht tiefer als es geht. Tiefer als die Welt, so tief hinab.
Und der Regen fällt weiter, fällt in mein Loch, fällt in die Tiefe. Alles wird nass, alles wird Wasser, die Pegel steigen und ich sinke. Tiefer, tiefer, wassertiefer.
Ich ersticke. Da ist nur Wasser um mich herum. Nur Wasser unter mir, nur Wasser über mir, in mir. Ich bin Wasser, schlucke Wasser, atme Wasser. Schnappe, schnappe, schnappe nach Luft - aber es ist keine da. Alles ist aufgebraucht, alles ist nichts, alles ist nass.
Und plötzlich hört der Regen auf, meine Schritte werden langsamer, ich bleibe stehen, sinke zu Boden. Ich bin gelaufen so weit wie noch nie, nur enge Gassen, aber ich weiß nicht wo.
Mein T-Shirt saugt sich voll, meine Haare tropfen, überall Tropfen. Sie springen auf und ab, hüpfen hin und her; und ich hechte hindurch. Laufe Zickzack und kann doch nicht entkommen, komme nicht davon, kann mich nicht retten, kann nur verlieren - egal bei welchem Spiel. Ich werde getroffen und getroffen und gehe doch nicht zu Boden.
Auch wenn alles mich nach unten zieht. Das Gewicht meines durchnässten Shirts, meiner klitschnassen Hose, alles reißt mich in die Tiefe. Ich werde schwerer und schwerer und schwerer. Ich sinke hinab. Ich falle. Falle. Falle. In der Falle.
So schwer, ich kann mich kaum bewegen. So schwer, ich kann mein Bein nicht mehr heben. So schwer, der Boden bricht unter mir. Und alles bricht ein, es geht tiefer als es geht. Tiefer als die Welt, so tief hinab.
Und der Regen fällt weiter, fällt in mein Loch, fällt in die Tiefe. Alles wird nass, alles wird Wasser, die Pegel steigen und ich sinke. Tiefer, tiefer, wassertiefer.
Ich ersticke. Da ist nur Wasser um mich herum. Nur Wasser unter mir, nur Wasser über mir, in mir. Ich bin Wasser, schlucke Wasser, atme Wasser. Schnappe, schnappe, schnappe nach Luft - aber es ist keine da. Alles ist aufgebraucht, alles ist nichts, alles ist nass.
Und plötzlich hört der Regen auf, meine Schritte werden langsamer, ich bleibe stehen, sinke zu Boden. Ich bin gelaufen so weit wie noch nie, nur enge Gassen, aber ich weiß nicht wo.
Mittwoch, 27. März 2013
Chaos.
Der Mülleimer quillt über, weil ich ihn nicht rausbringe, nicht entleere, mir nicht mehr die Mühe gebe, die zerknüllten Zettel ordentlich hineinzuschmeißen.
Ich hasse diese Unordnung. Sie ist so hässlich abstoßend. Und doch so richtig. Weil mein Kopf sich genauso anfühlt, genauso übervoll ist, genauso voll mit zerknüllten Ideen, weggeworfenen Gedanken, Notizen, Kritzeleien.
Ich will keine Ordnung sehen. Ich will nicht vergleichen müssen, um dann zu merken, was für ein Chaos in mir herrscht. Das sichtbare Chaos schiebe ich vor; das ist wenigstens durchschaubar. Und wenigstens habe ich rein theoretisch die Chance, es aufzuräumen und zu sortieren.
Auch die Klamotten, die auf dem weißen Boden verstreut liegen, könnte ich in meinen Schrank hängen. Aber ich mache es nicht. Ich trete sie lieber beiseite, wenn ich durch mein Zimmer stapfe, wühle mich durch sie hindurch, wenn ich etwas suche und zerknülle sie dann entnervt.
Meine Wut lasse ich an den Kleidungsstücken aus. Alles, was sich anstaut. Alles, was mich ankotzt. Vor allem ist es die Wut darüber, dass ich im Chaos versinke. Und nichts dagegen tun kann.
Ich hasse diese Unordnung. Sie ist so hässlich abstoßend. Und doch so richtig. Weil mein Kopf sich genauso anfühlt, genauso übervoll ist, genauso voll mit zerknüllten Ideen, weggeworfenen Gedanken, Notizen, Kritzeleien.
Ich will keine Ordnung sehen. Ich will nicht vergleichen müssen, um dann zu merken, was für ein Chaos in mir herrscht. Das sichtbare Chaos schiebe ich vor; das ist wenigstens durchschaubar. Und wenigstens habe ich rein theoretisch die Chance, es aufzuräumen und zu sortieren.
Auch die Klamotten, die auf dem weißen Boden verstreut liegen, könnte ich in meinen Schrank hängen. Aber ich mache es nicht. Ich trete sie lieber beiseite, wenn ich durch mein Zimmer stapfe, wühle mich durch sie hindurch, wenn ich etwas suche und zerknülle sie dann entnervt.
Meine Wut lasse ich an den Kleidungsstücken aus. Alles, was sich anstaut. Alles, was mich ankotzt. Vor allem ist es die Wut darüber, dass ich im Chaos versinke. Und nichts dagegen tun kann.
Freitag, 15. März 2013
Im Seifenblasenwunderland.
Im Seifenblasenwunderland wird jeder Traum wahr. Und aus jeder klitzekleinen Ideenblase wird ein riesiger Erfolg. Alles glitzert und funkelt nur so, dass man sich fast die Augen zuhalten muss. Aber nur fast. Überall sind Regenbogen der Reflexionen zu sehen, alles strahlt in großer Farbenpracht. Jeder findet seine Lieblingsfarbe wieder, wie sie durch die Lüfte schwebt und Kreise zieht. Es gibt rot und blau, neonorange und pinkgrünkariert, kuntergraudunkelblund für die Älteren und kräftige, starke Wachsmalfarben für die Kleineren.
Immer ist gutes Wetter. Wenn die Sonne scheint, dann lacht sie mit den Einwohnern um die Wette, und wenn es regnet, spielen die vielen kleinen und großen blauen Regentropfen mit den vielen großen und kleinen glitzernden Seifenblasen. An solchen Tagen ist viel los im Seifenblasenwunderland, denn die Bewohner treten aus ihren Traumhäusern, um den Tropfen und den Seifenblasen beim Spaßhaben zuzuschauen. Sie alle lächeln und lachen und freuen sich - und wer schon mal eine Seifenblase lachen gehört hat, der weiß, wie ansteckend das ist.
Niemand ist mehr traurig an solchen Tagen, nur ganz wenig Kummer zieht auch in den übrigen Wochen in diesem Land umher. Denn wann auch immer Leere, Einsamkeit oder Angst in eine Person einzieht, so kommt doch immer schnell ein Schwarm funkelnder Seifenblasen an, der durch die Haut und durch den Mund in jeden Körperraum eindringt und die triste Leere füllt, der Angst das Fürchten lehrt sowie alle Einsamkeit mit Leben bereichert.
So strahlen die Bewohner des Seifenblasenwunderlands von innen heraus. Sie glitzern und funkeln mit den luftigen Blasen um die Wette. Aber keiner von ihnen verliert. Denn alle sind gleich viel wert in diesem Land; ein großer Seifenblasentraum zählt nicht mehr als eine klitzekleine Hoffnung und ein riesiger Mann ist nicht bunter als ein Mini-Mensch.
Keine Seifenblase ist je zerplatzt und weil immer neue Menschen mit immer neuen Träumen hinzukommen, vermehren sich die Blasen rasend schnell. Sodass die ganze Seifenblasenwunderwelt nur noch aus luftig weichen Seifenblasen besteht und es überall gemütlich ist.
Egal ob in meinem oder deinem oder unserem Traum, überall lebe ich gern, überall glitzert es schön, jeder Wunsch kann gleichzeitig bestehen.
Und niemals läuft jemand mit Messern durch das Land, keiner zersticht die zerbrechlichen Seifenblasen, niemand der einen anderen zerstört.
So lässt es sich leben, im Seifenblasenwunderland.
Immer ist gutes Wetter. Wenn die Sonne scheint, dann lacht sie mit den Einwohnern um die Wette, und wenn es regnet, spielen die vielen kleinen und großen blauen Regentropfen mit den vielen großen und kleinen glitzernden Seifenblasen. An solchen Tagen ist viel los im Seifenblasenwunderland, denn die Bewohner treten aus ihren Traumhäusern, um den Tropfen und den Seifenblasen beim Spaßhaben zuzuschauen. Sie alle lächeln und lachen und freuen sich - und wer schon mal eine Seifenblase lachen gehört hat, der weiß, wie ansteckend das ist.
Niemand ist mehr traurig an solchen Tagen, nur ganz wenig Kummer zieht auch in den übrigen Wochen in diesem Land umher. Denn wann auch immer Leere, Einsamkeit oder Angst in eine Person einzieht, so kommt doch immer schnell ein Schwarm funkelnder Seifenblasen an, der durch die Haut und durch den Mund in jeden Körperraum eindringt und die triste Leere füllt, der Angst das Fürchten lehrt sowie alle Einsamkeit mit Leben bereichert.
So strahlen die Bewohner des Seifenblasenwunderlands von innen heraus. Sie glitzern und funkeln mit den luftigen Blasen um die Wette. Aber keiner von ihnen verliert. Denn alle sind gleich viel wert in diesem Land; ein großer Seifenblasentraum zählt nicht mehr als eine klitzekleine Hoffnung und ein riesiger Mann ist nicht bunter als ein Mini-Mensch.
Keine Seifenblase ist je zerplatzt und weil immer neue Menschen mit immer neuen Träumen hinzukommen, vermehren sich die Blasen rasend schnell. Sodass die ganze Seifenblasenwunderwelt nur noch aus luftig weichen Seifenblasen besteht und es überall gemütlich ist.
Egal ob in meinem oder deinem oder unserem Traum, überall lebe ich gern, überall glitzert es schön, jeder Wunsch kann gleichzeitig bestehen.
Und niemals läuft jemand mit Messern durch das Land, keiner zersticht die zerbrechlichen Seifenblasen, niemand der einen anderen zerstört.
So lässt es sich leben, im Seifenblasenwunderland.
Donnerstag, 14. März 2013
Unraum.
Ob es wohl noch Orte auf der Erde gibt, die kein Mensch je gesehen hat?
Die nicht nur unberührt, sondern auch unbetrachtet, ungesehen, ungeachtet sind?
Die niemand vermissen würde? An denen sich alles verstecken könnte? Die sich vielleicht täglich ändern?
Wie viel Unraum wohl existiert, zwischen Straßen und Regeln und Wohnkomplexen. Wie viel nie betreten wird. Wie viele Welten unentdeckt.
Was dort wohl haust und graust und sich verkrochen hat?
Und was wohl geschieht, wenn an einem Tag, mitten im Leben, irgendwer die Schwelle überschreitet, den Unraum betritt, das Unbekannte entdeckt?
Vielleicht verschwindet all das Neue dann, all das Unentdeckte ist dann fort. Weil es nur im Geheimen existieren kann und Aufspürung unmöglich ist - denn bei Entdeckung ist es unentdeckbar.
Ein Paradox der Welt. Das für immer unbekannt bleiben wird.
Und vielleicht werde ich morgen einen Unraum betreten, ohne jemals davon zu wissen. Vielleicht hat vor mir niemand diesen Fleck berührt.
Auch wenn es nur ein Millimeter ist. Ich habe ihn gesehen.
Die nicht nur unberührt, sondern auch unbetrachtet, ungesehen, ungeachtet sind?
Die niemand vermissen würde? An denen sich alles verstecken könnte? Die sich vielleicht täglich ändern?
Wie viel Unraum wohl existiert, zwischen Straßen und Regeln und Wohnkomplexen. Wie viel nie betreten wird. Wie viele Welten unentdeckt.
Was dort wohl haust und graust und sich verkrochen hat?
Und was wohl geschieht, wenn an einem Tag, mitten im Leben, irgendwer die Schwelle überschreitet, den Unraum betritt, das Unbekannte entdeckt?
Vielleicht verschwindet all das Neue dann, all das Unentdeckte ist dann fort. Weil es nur im Geheimen existieren kann und Aufspürung unmöglich ist - denn bei Entdeckung ist es unentdeckbar.
Ein Paradox der Welt. Das für immer unbekannt bleiben wird.
Und vielleicht werde ich morgen einen Unraum betreten, ohne jemals davon zu wissen. Vielleicht hat vor mir niemand diesen Fleck berührt.
Auch wenn es nur ein Millimeter ist. Ich habe ihn gesehen.
Montag, 11. März 2013
Blickkontakt.
Unsere Blicke treffen sich. Ganz kurz nur. Ein Augenblick, in dem ich in ihre und sie in meine Richtung schaut. Und dann wenden wir uns beide wieder ab. Als wäre es abgesprochen, als wären wir erwischt worden bei etwas, das nicht gestattet ist.
Wir kennen uns nicht und wir werden uns nie wieder sehen. Ganz zufällig saßen wir im selben Restaurant, ganz zufällig trafen sich unsere Blicke, ganz schnell wendeten wir uns wieder dem Essen vor uns zu.
Dauernd passiert es. Dauernd mit anderen Personen. In Bahnen, auf der Straße, in Cafés und in der Schule. Mit Fremden, Freunden und Bekannten. Immer wieder ist er da, dieser eine Moment, in dem man sich anschaut. Und dann immer wieder das beschämte Wegschauen.
Als dürfte ich nicht anschauen, wen ich will. Hinschauen, wo ich will. Wegschauen, wann ich will.
Aus so viel Abstand und so viel Distanz besteht unser Leben, dass selbst die Augen der Menschen um uns herum unangenehm werden, wenn sie auf uns gerichtet sind. Wir fühlen uns dauerhaft entdeckt und können gleichzeitig nirgendwo hinschauen, ohne uns selbst zu verraten.
Die Blicke bleiben gesenkt. So sehr schämt sich die Welt.
Wir kennen uns nicht und wir werden uns nie wieder sehen. Ganz zufällig saßen wir im selben Restaurant, ganz zufällig trafen sich unsere Blicke, ganz schnell wendeten wir uns wieder dem Essen vor uns zu.
Dauernd passiert es. Dauernd mit anderen Personen. In Bahnen, auf der Straße, in Cafés und in der Schule. Mit Fremden, Freunden und Bekannten. Immer wieder ist er da, dieser eine Moment, in dem man sich anschaut. Und dann immer wieder das beschämte Wegschauen.
Als dürfte ich nicht anschauen, wen ich will. Hinschauen, wo ich will. Wegschauen, wann ich will.
Aus so viel Abstand und so viel Distanz besteht unser Leben, dass selbst die Augen der Menschen um uns herum unangenehm werden, wenn sie auf uns gerichtet sind. Wir fühlen uns dauerhaft entdeckt und können gleichzeitig nirgendwo hinschauen, ohne uns selbst zu verraten.
Die Blicke bleiben gesenkt. So sehr schämt sich die Welt.
Dienstag, 5. März 2013
Ende gut.
"Doch was kommt nach dem Happy End?"
Wenn die Kamerateams verschwinden. Wenn jeder den gewohnten Weg weitergeht, das gewohnte Leben weiterlebt, weil alles geklärt ist. Weil alles gut ist. Für den Moment.
Kurze Phasen des Glücks stehen plötzlich am Ende. Als wär danach Schluss. Als würde es danach ewig so weitergehen. Als wenn Leben nicht Hoch und Tief wäre; nicht unten und oben; nicht Ende und Anfang.
Was danach kommt, ist nicht der Schluss. Sondern eine neue Geschichte.
Filme und Bücher müssen irgendwo aufhören, müssen etwas beenden, was nicht beendet werden kann. Müssen abschließen - abschneiden, was noch folgen könnte.
Und dann steht da das Ende. Das glückliche Ende. Um Glück zu hinterlassen. Um Hoffnung zu verbreiten.
Dabei ist da eigentlich nichts als Ungewissheit. Nichts als die naive Sehnsucht nach unendlichem Jubel, unendlichen Glücksgefühlen, die doch eigentlich nur für Augenblicke gelten.
"Zum Schluss kommt ein Kuss,
das Gute siegt, weil es siegen muss."
Weil es immer so war. Weil es sich so gehört. Und weil Gerechtigkeit scheinbar selbstverständlich ist. Doch wenn sich jeder als gut definiert, geht die Rechnung nicht auf.
Jemand wird verlieren. Bloß sind das immer die anderen, wenn der Blickwinkel stimmt.
Das Happy End derjenigen folgt auf den nächsten vier Seiten. Nach dem Nachwort, wenn das Buch zugeklappt ist, wenn es im Regal steht. Oder nach dem Film, nach dem Abspann, nachdem jeder einzelne Schauspieler aufgelistet wurde.
Wenn ich abschalte, beginnt der nächste Film. Ich kann nichts tun. Außer so zu tun, als wüsste ich es nicht. Als wär mein Happy End endlos.
[Madsen]
Wenn die Kamerateams verschwinden. Wenn jeder den gewohnten Weg weitergeht, das gewohnte Leben weiterlebt, weil alles geklärt ist. Weil alles gut ist. Für den Moment.
Kurze Phasen des Glücks stehen plötzlich am Ende. Als wär danach Schluss. Als würde es danach ewig so weitergehen. Als wenn Leben nicht Hoch und Tief wäre; nicht unten und oben; nicht Ende und Anfang.
Was danach kommt, ist nicht der Schluss. Sondern eine neue Geschichte.
Filme und Bücher müssen irgendwo aufhören, müssen etwas beenden, was nicht beendet werden kann. Müssen abschließen - abschneiden, was noch folgen könnte.
Und dann steht da das Ende. Das glückliche Ende. Um Glück zu hinterlassen. Um Hoffnung zu verbreiten.
Dabei ist da eigentlich nichts als Ungewissheit. Nichts als die naive Sehnsucht nach unendlichem Jubel, unendlichen Glücksgefühlen, die doch eigentlich nur für Augenblicke gelten.
"Zum Schluss kommt ein Kuss,
das Gute siegt, weil es siegen muss."
Weil es immer so war. Weil es sich so gehört. Und weil Gerechtigkeit scheinbar selbstverständlich ist. Doch wenn sich jeder als gut definiert, geht die Rechnung nicht auf.
Jemand wird verlieren. Bloß sind das immer die anderen, wenn der Blickwinkel stimmt.
Das Happy End derjenigen folgt auf den nächsten vier Seiten. Nach dem Nachwort, wenn das Buch zugeklappt ist, wenn es im Regal steht. Oder nach dem Film, nach dem Abspann, nachdem jeder einzelne Schauspieler aufgelistet wurde.
Wenn ich abschalte, beginnt der nächste Film. Ich kann nichts tun. Außer so zu tun, als wüsste ich es nicht. Als wär mein Happy End endlos.
[Madsen]
Montag, 4. März 2013
Sonnentanz.
"Wenn morgen die Sonne scheint, kann alles so schlimm nicht sein"
[Jupiter Jones]
Die Sonne scheint. Den ganzen Tag.
Der Himmel strahlt in blau. So weit ich blicken kann.
Die Vögel zwitschern. Ihr Lied begleitet mich schon beim Aufstehen morgens. Und bringt mich durch den Tag.
Jede Schulstunde ist beim Blick aus dem Fenster nur halb so schlimm. Und auch den Lehrern, die ich eigentlich gar nicht leiden kann, höre ich heute gerne zu. Mitschüler, die sich normalerweise keines Blickes würdigen, lachen heute zusammen. Und auch wer einsam den Tag verbringt, fühlt sich überall zuhause heut.
Überall ist Leben. Und überall sieht man, wie jemand Neues angesteckt wird. Mit Leben infiziert; Lächeln eingeimpft.
Es ist, als würde jeder dem Nachbarn näherkommen. Jeder den Nächsten verstehen. Und als würde jeder dasselbe Ziel, dieselbe Hoffnung in sich tragen.
Sehnsucht nach Sonne. Und die Hoffnung, dass der Frühling bleibt.
Bis zum nächsten Nebel und zum nächsten kalten Regen sind wir alle vereint.
"Heut schlafen wir selig ein, weil morgen die Sonne scheint."
[Jupiter Jones]
[Jupiter Jones]
Die Sonne scheint. Den ganzen Tag.
Der Himmel strahlt in blau. So weit ich blicken kann.
Die Vögel zwitschern. Ihr Lied begleitet mich schon beim Aufstehen morgens. Und bringt mich durch den Tag.
Jede Schulstunde ist beim Blick aus dem Fenster nur halb so schlimm. Und auch den Lehrern, die ich eigentlich gar nicht leiden kann, höre ich heute gerne zu. Mitschüler, die sich normalerweise keines Blickes würdigen, lachen heute zusammen. Und auch wer einsam den Tag verbringt, fühlt sich überall zuhause heut.
Überall ist Leben. Und überall sieht man, wie jemand Neues angesteckt wird. Mit Leben infiziert; Lächeln eingeimpft.
Es ist, als würde jeder dem Nachbarn näherkommen. Jeder den Nächsten verstehen. Und als würde jeder dasselbe Ziel, dieselbe Hoffnung in sich tragen.
Sehnsucht nach Sonne. Und die Hoffnung, dass der Frühling bleibt.
Bis zum nächsten Nebel und zum nächsten kalten Regen sind wir alle vereint.
"Heut schlafen wir selig ein, weil morgen die Sonne scheint."
[Jupiter Jones]
Freitag, 1. März 2013
Die Weisheit des Teetrinkens.
Er öffnet langsam die Augen, reckt die Arme in die Höhe und
streckt seine Nase dorthin, wo ein wenig Licht durch den kleinen Spalt des
Rollos fällt. Sonnenlicht, morgens schon. Der Frühling kommt tatsächlich.
Lächelnd dreht er sich auf die Seite und schließt die Augen ein weiteres Mal. Allerdings nur dazu, um sie eine Sekunde später sofort geschockt wieder aufzureißen. Der unterbewusste Blick auf die digitale Anzeiger des Weckers veranlasst ihn dazu, denn von seinem Nachttisch aus leuchtet ihm bedrohlich 7:22 in roten Ziffern entgegen.
„Scheiß Teil!“, ruft er laut und weckt sich damit selber gänzlich auf. „Was klingelst du denn nie?!“ Als grausame Antwort springt die Anzeige auf 7:23 um.
Er wirft die Bettdecke beiseite, läuft zum Schrank, stößt sich auf halbem Weg den großen Zeh und springt dann auf einem Bein weiter. Mit ein paar der obersten Kleidungsstücke auf dem Arm hüpft er ins Badezimmer und spritzt sich Wasser ins Gesicht. Das frische T-Shirt halb über den Kopf gezogen, hinkt er daraufhin eilig ins Wohnzimmer, um den eingehenden Anruf denkbar knapp zu verpassen.
„Arschlöcher!“, brüllt er in den toten Hörer und knallt ihn auf den Tisch.
In T-Shirt und Boxershorts gekleidet, öffnet er die Tür zur Küche und seine Katze springt ihn mit scharfen Krallen an.
„Miau!“, ruft sie und wirft ihm damit deutlich hörbar vor, über Nacht eingesperrt gewesen zu sein. Was er davon hat, sieht er im nächsten Moment. Der Boden der Küche ist mit Essensresten und Fetzen von Papiertüchern übersät, die birkenfarbenen Schränke sind zerkratzt.
„Du Mistvieh!“, ruft er aus, während ihm kurz nach dem Aufsetzen des nackten Fußes die kleine Pfütze auf dem Boden auffällt. „Du verdammtes Miestvieh!“
„Miau!“, antwortet seine Katze, ganz ohne Reue in der dünnen Stimme.
Er geht leicht humpelnd zur Spüle und versucht sich so zu verrenken, dass er den verletzten und nun auch benässten Fuß unter das laufende Wasser halten kann. Es spritzt auf den Boden, gegen die Wände und auf sein frisches T-Shirt, allerdings nicht auf die richtige Stelle, sodass er nach einigen Versuchen genervt aufgibt und das Wasser stattdessen in den Wasserkocher füllt.
„Wenigstens gibt es noch Tee“, sagt er, während er das Regal öffnet und ihm die unterschiedlichsten Teesorten auf den Kopf fallen.
Er schließt die Augen und schüttelt den Kopf, hebt einen Beutel auf und hängt ihn in seine Tasse, die zwar nicht abgewaschen ist, aber sauber aussieht.
Mit lautem Brodeln kündigt das Wasser an, nun heiß genug zu sein, daher hebt er den Wasserkocher an und schüttet sich etwas auf den Teebeutel und aus Versehen auch auf seine Hand.
„Au, scheiße!“, brüllt er und schafft es gerade noch, die Tasse festzuhalten. Er schleppt sich mit ihr zum kleinen Küchentisch und lauscht der Musik aus dem Radio, das wohl seit dem Vortag durchgehend läuft.
„Lasst uns lernen, uns mehr zu freuen“, liest er auf dem kleinen Zettel seines Yogi-Tees.
„Ach, leckt mich doch!“, denkt er sich, bleibt jedoch ruhig. Er legt seinen Kopf auf den Tisch und versucht, die Stille zu genießen, die nur dadurch gestört wird, dass seine Katze scheinbar gerade das Badezimmer ausräumt und der Radiomoderator Telefonstreiche ausprobiert.
Lächelnd dreht er sich auf die Seite und schließt die Augen ein weiteres Mal. Allerdings nur dazu, um sie eine Sekunde später sofort geschockt wieder aufzureißen. Der unterbewusste Blick auf die digitale Anzeiger des Weckers veranlasst ihn dazu, denn von seinem Nachttisch aus leuchtet ihm bedrohlich 7:22 in roten Ziffern entgegen.
„Scheiß Teil!“, ruft er laut und weckt sich damit selber gänzlich auf. „Was klingelst du denn nie?!“ Als grausame Antwort springt die Anzeige auf 7:23 um.
Er wirft die Bettdecke beiseite, läuft zum Schrank, stößt sich auf halbem Weg den großen Zeh und springt dann auf einem Bein weiter. Mit ein paar der obersten Kleidungsstücke auf dem Arm hüpft er ins Badezimmer und spritzt sich Wasser ins Gesicht. Das frische T-Shirt halb über den Kopf gezogen, hinkt er daraufhin eilig ins Wohnzimmer, um den eingehenden Anruf denkbar knapp zu verpassen.
„Arschlöcher!“, brüllt er in den toten Hörer und knallt ihn auf den Tisch.
In T-Shirt und Boxershorts gekleidet, öffnet er die Tür zur Küche und seine Katze springt ihn mit scharfen Krallen an.
„Miau!“, ruft sie und wirft ihm damit deutlich hörbar vor, über Nacht eingesperrt gewesen zu sein. Was er davon hat, sieht er im nächsten Moment. Der Boden der Küche ist mit Essensresten und Fetzen von Papiertüchern übersät, die birkenfarbenen Schränke sind zerkratzt.
„Du Mistvieh!“, ruft er aus, während ihm kurz nach dem Aufsetzen des nackten Fußes die kleine Pfütze auf dem Boden auffällt. „Du verdammtes Miestvieh!“
„Miau!“, antwortet seine Katze, ganz ohne Reue in der dünnen Stimme.
Er geht leicht humpelnd zur Spüle und versucht sich so zu verrenken, dass er den verletzten und nun auch benässten Fuß unter das laufende Wasser halten kann. Es spritzt auf den Boden, gegen die Wände und auf sein frisches T-Shirt, allerdings nicht auf die richtige Stelle, sodass er nach einigen Versuchen genervt aufgibt und das Wasser stattdessen in den Wasserkocher füllt.
„Wenigstens gibt es noch Tee“, sagt er, während er das Regal öffnet und ihm die unterschiedlichsten Teesorten auf den Kopf fallen.
Er schließt die Augen und schüttelt den Kopf, hebt einen Beutel auf und hängt ihn in seine Tasse, die zwar nicht abgewaschen ist, aber sauber aussieht.
Mit lautem Brodeln kündigt das Wasser an, nun heiß genug zu sein, daher hebt er den Wasserkocher an und schüttet sich etwas auf den Teebeutel und aus Versehen auch auf seine Hand.
„Au, scheiße!“, brüllt er und schafft es gerade noch, die Tasse festzuhalten. Er schleppt sich mit ihr zum kleinen Küchentisch und lauscht der Musik aus dem Radio, das wohl seit dem Vortag durchgehend läuft.
„Lasst uns lernen, uns mehr zu freuen“, liest er auf dem kleinen Zettel seines Yogi-Tees.
„Ach, leckt mich doch!“, denkt er sich, bleibt jedoch ruhig. Er legt seinen Kopf auf den Tisch und versucht, die Stille zu genießen, die nur dadurch gestört wird, dass seine Katze scheinbar gerade das Badezimmer ausräumt und der Radiomoderator Telefonstreiche ausprobiert.
Zögernd hebt er den Kopf wieder. Er lässt seinen Blick durch
den kahlen Raum schweifen. Die nackten Wände, das kleine Bett, die
Gitterstreben vor dem Fenster.
Seufzend erhebt er sich von dem kleinen Stuhl, schleicht zur Wand gegenüber, ritzt einen weiteren Strich für einen weiteren Tag in der JVA ein. Und als er sich aufs Bett fallen lässt, kann er die Tränen nicht zurückhalten.
Auf dem Tisch steht kalter Tee, ein Schild hängt aus der Tasse.
Seufzend erhebt er sich von dem kleinen Stuhl, schleicht zur Wand gegenüber, ritzt einen weiteren Strich für einen weiteren Tag in der JVA ein. Und als er sich aufs Bett fallen lässt, kann er die Tränen nicht zurückhalten.
Auf dem Tisch steht kalter Tee, ein Schild hängt aus der Tasse.
„Mach deine Gedanken nicht zu deinem Gefängnis“
Dienstag, 26. Februar 2013
Und immer wieder.
Und immer wieder. Denke ich in einzelnen Worten. Und nicht zusammenhängenden Sätzen. Kann nicht formulieren, was ich sagen will. Weiß nicht, was in mir ist.
Und immer wieder. Klingt jedes Wort falsch. Und jeder Satz unpassend. Nichts ist richtig, auch wenn es keine Fehler gibt. Die Auswahl ist so groß. An Vokabeln, an Satzbausteinen, an Ideen. Und doch geht nicht zusammen, was zusammengehört.
Und immer wieder. Schweben mir Halbsätze im Kopf. Die keinen Sinn ergeben. Die ich nicht zuordnen kann. Die einfach da sind. Ich kann ihre Bedeutung nicht sehen, obwohl sie vielleicht wichtig ist. Bin auf der Suche danach, obwohl es keinen Ort gibt, an dem ich sie finden könnte.
Und immer wieder. Wimmelt es in meinem Kopf von Buchstaben. Sie mischen sich durch, formen immer neue Wörter. Viel zu schnell, sodass ich kaum eins festhalten kann. Weder auf Papier noch in meinem Gedächtnis.
Und immer wieder. Reihe ich die Sätze aneinander. Und finde mich darin wieder. Weil ich es bin.
Und immer wieder. Unterbewusst.
Und immer wieder merke ich, wie viel ich aus nur drei Worten ziehen kann. Wie viel in dem steckt, was mein Geist entwickelt.
Und immer wieder. Klingt jedes Wort falsch. Und jeder Satz unpassend. Nichts ist richtig, auch wenn es keine Fehler gibt. Die Auswahl ist so groß. An Vokabeln, an Satzbausteinen, an Ideen. Und doch geht nicht zusammen, was zusammengehört.
Und immer wieder. Schweben mir Halbsätze im Kopf. Die keinen Sinn ergeben. Die ich nicht zuordnen kann. Die einfach da sind. Ich kann ihre Bedeutung nicht sehen, obwohl sie vielleicht wichtig ist. Bin auf der Suche danach, obwohl es keinen Ort gibt, an dem ich sie finden könnte.
Und immer wieder. Wimmelt es in meinem Kopf von Buchstaben. Sie mischen sich durch, formen immer neue Wörter. Viel zu schnell, sodass ich kaum eins festhalten kann. Weder auf Papier noch in meinem Gedächtnis.
Und immer wieder. Reihe ich die Sätze aneinander. Und finde mich darin wieder. Weil ich es bin.
Und immer wieder. Unterbewusst.
Und immer wieder merke ich, wie viel ich aus nur drei Worten ziehen kann. Wie viel in dem steckt, was mein Geist entwickelt.
Montag, 25. Februar 2013
Auf der Suche nach dem Ziel.
Ich höre Musik und versuche, in mir zu versinken. Versuche, mich wegzudenken, alles andere abzuschalten. All die Menschen. Neben mir, gegenüber und hinter mir. Unterwegs - sind sie alle. Reisende. Auf dem Weg.
Ob sie sich wohl freuen auf das, was sie erwartet? Ob sie endlich nach Hause dürfen? Oder dem hinterhertrauern, was sie mit jeder Sekunde weiter hinter sich lassen. Ob sie zurück müssen in alte, enge Orte? Oder Angst haben vor neuem, unbekannten Gebiet.
Ob für sie fremd ist, was ich Heimat nenne? Ob ihre Reise beginnt, wenn meine dabei ist, zu enden? Ob sie Freudentränen weinen, wenn meine vor Sehnsucht rollen? Ob sie erwartet werden; am Gleis jemand steht, der die Arme um sie legt? Der jetzt in der Kälte friert und aufgeregt den Zug ersehnt.
Die Schaffnerin kündigt den nächsten Halt an, der mit wenigen Minuten Verspätung erreicht wird. Menschen stehen auf, greifen nach ihren Taschen, verstauen Bücher und Getränke in Koffern, zwängen sich in dicke Wintermäntel. Ein weiterer Bahnhof, ein weiterer Ort, der Heimat ist, und weitere Menschen, die angekommen sind. Ich blicke nach draußen in geschäftigen Trubel, freudigen Jubel, Abschiedsküsse und Willkommensgrüße, schnelle Schritte, suchende Blicke.
Und dann reisen wir weiter, verlassen das Gleis und verlassen die Stadt. Die Lichter des Bahnhofs verblassen, die monotone Dunkelheit gewinnt wieder die Überhand. Alle, was ich erkenne, ist die Spiegelung des Abteils, in dem ich sitze. Die Mitreisenden, die mir fremd sind, obwohl sie vielleicht dasselbe fühlen wie ich, die Koffer und Taschen, die mit Leben der anderen gefüllt sind, Bücher, Handys und Laptops als einzige Begleiter. Und mein trauriger Blick, wie er in der Scheibe erscheint, während ich in mir versinke und mir vorstelle, rückwärts zu fahren. Zu dir zurück.
Und zwischen Linkin Park und Liebeslied verfluche ich die Kilometer. Und bin doch froh, ein Ziel zu haben.
Ob sie sich wohl freuen auf das, was sie erwartet? Ob sie endlich nach Hause dürfen? Oder dem hinterhertrauern, was sie mit jeder Sekunde weiter hinter sich lassen. Ob sie zurück müssen in alte, enge Orte? Oder Angst haben vor neuem, unbekannten Gebiet.
Ob für sie fremd ist, was ich Heimat nenne? Ob ihre Reise beginnt, wenn meine dabei ist, zu enden? Ob sie Freudentränen weinen, wenn meine vor Sehnsucht rollen? Ob sie erwartet werden; am Gleis jemand steht, der die Arme um sie legt? Der jetzt in der Kälte friert und aufgeregt den Zug ersehnt.
Die Schaffnerin kündigt den nächsten Halt an, der mit wenigen Minuten Verspätung erreicht wird. Menschen stehen auf, greifen nach ihren Taschen, verstauen Bücher und Getränke in Koffern, zwängen sich in dicke Wintermäntel. Ein weiterer Bahnhof, ein weiterer Ort, der Heimat ist, und weitere Menschen, die angekommen sind. Ich blicke nach draußen in geschäftigen Trubel, freudigen Jubel, Abschiedsküsse und Willkommensgrüße, schnelle Schritte, suchende Blicke.
Und dann reisen wir weiter, verlassen das Gleis und verlassen die Stadt. Die Lichter des Bahnhofs verblassen, die monotone Dunkelheit gewinnt wieder die Überhand. Alle, was ich erkenne, ist die Spiegelung des Abteils, in dem ich sitze. Die Mitreisenden, die mir fremd sind, obwohl sie vielleicht dasselbe fühlen wie ich, die Koffer und Taschen, die mit Leben der anderen gefüllt sind, Bücher, Handys und Laptops als einzige Begleiter. Und mein trauriger Blick, wie er in der Scheibe erscheint, während ich in mir versinke und mir vorstelle, rückwärts zu fahren. Zu dir zurück.
Und zwischen Linkin Park und Liebeslied verfluche ich die Kilometer. Und bin doch froh, ein Ziel zu haben.
Freitag, 15. Februar 2013
Ende des Weges.
Ich möchte eine Liste haben. Eine Liste mit all den Personen, die mich im Leben ein Stück begleitet haben. Die mir etwas gegeben haben, die mir etwas gezeigt haben, die mir Mut gemacht haben. Diejenigen, an die ich mich heute noch erinnere. Obwohl sie vielleicht schon lange nicht mehr da sind.
Was habe ich von ihnen? Wie oft denke ich an sie? Und vor allem, warum besteht unsere Freundschaft, unsere Bekanntschaft, unser gemeinsamer Wegabschnitt nicht mehr?
Mir fallen so viele Leute ein.
Verwandte, die gestorben sind.
Freunde aus der Grundschule, dich ich früher täglich gesehen habe. Und von denen ich heute nicht mal mehr weiß, ob sie noch leben.
Internet-Bekanntschaften, die plötzlich nicht mehr on kamen und auf keine Nachrichten mehr antworteten.
Ehemalige Freunde, denen ich immer mal wieder begegne. Bei denen ich mir aber nicht mehr sicher bin, ob sie mich noch erkennen.
Einigen trauere ich hinterher. Frage mich, was aus ihnen wohl geworden ist. Wüsste es gerne.
Bei anderen akzeptiere ich das Ende des gemeinsamen Weges widerstandslos.
Von manchen habe ich mich verabschiedet, andere verschwanden plötzlich. An einige denke ich täglich, andere tauchen nur selten in Erinnerungen auf.
Und ich frage mich, welche meiner jetzigen Freunde sich wohl während all dieser Gedanken langsam von mir entfernen. Wer wohl morgen nicht mehr da sein wird? Welches Gespräch, das ich führe, wohl ein letztes sein wird.
Und dann kehren meine Gedanken zu den Vergangenen zurück. Zu all denjenigen, an die ich mich heute nicht mehr erinnere. Die sich schon so weit entfernt haben, dass sie gelöscht sind - unwiderruflich.
Bei wem ich mich wohl noch in Erinnerung befinde?
Montag, 11. Februar 2013
Neben der Vergangenheit.
Was geschehen ist, ist geschehen.
Was getan wurde, ist getan.
Was gelebt wurde, ist gelebt.
Und damit schließe ich ab. Ich beende es in mir. Beende die Gedanken darüber. Beende die Gespräche darüber. Beende alle Inhalte.
Und ich schaue nach vorn. Denke an nichts, woran ich nicht denken will. Blende alle Einwände aus. Und freue mich.
Ich laufe in die Zukunft - im Sprint und Dauerlauf. Ich renne mit dem Blick in weite Fernen.
Bis ich plötzlich etwas fühle hinter mir. Einen Stich, etwas Großes. Und in mir wird es kalt. Meine Haare stellen sich auf, ich beginne zu zittern. Meine Schritte werden langsamer. Der Puls beschleunigt sich.
Langsam, ganz langsam drehe ich meinen Kopf. Blicke hinter mich. Blicke in das Monster der Vergangenheit, was mich eingeholt hat - locker. Ich bin völlig außer Atem, am Ende meiner Kräfte. Das Monster hebt seine Hand zum Gruß.
Ich erkenne vieles wieder, was unter den dunklen Schleiern haust. Personen, die mich immer wieder auf das hinweisen, was ich abgehakt habe. Ehemalige Freunde, die sich in die Gegenwart drängen. Briefe, Fotos, Eintrittskarten, die in Ritzen und dunklen Ecken auftauchen. Und ich. Wie ich war und wie ich bin; wie ich mich entwickelt habe und was alles noch in mir steckt. Und sich nicht einfach streichen lässt.
So erwidere ich den Gruß des Monsters, verringere meine Geschwindigkeit und lasse es neben mir laufen. Ich blicke es an und sehe mich. Lächle mich an und nicke meiner Vergangenheit zu, die mich auf meinem Weg in die Zukunft begleitet.
Was geschehen ist, hilft mir, mich zu entscheiden.
Was getan wurde, gibt mir Erfahrung und Mut.
Was gelebt wurde, bin ich.
Was getan wurde, ist getan.
Was gelebt wurde, ist gelebt.
Und damit schließe ich ab. Ich beende es in mir. Beende die Gedanken darüber. Beende die Gespräche darüber. Beende alle Inhalte.
Und ich schaue nach vorn. Denke an nichts, woran ich nicht denken will. Blende alle Einwände aus. Und freue mich.
Ich laufe in die Zukunft - im Sprint und Dauerlauf. Ich renne mit dem Blick in weite Fernen.
Bis ich plötzlich etwas fühle hinter mir. Einen Stich, etwas Großes. Und in mir wird es kalt. Meine Haare stellen sich auf, ich beginne zu zittern. Meine Schritte werden langsamer. Der Puls beschleunigt sich.
Langsam, ganz langsam drehe ich meinen Kopf. Blicke hinter mich. Blicke in das Monster der Vergangenheit, was mich eingeholt hat - locker. Ich bin völlig außer Atem, am Ende meiner Kräfte. Das Monster hebt seine Hand zum Gruß.
Ich erkenne vieles wieder, was unter den dunklen Schleiern haust. Personen, die mich immer wieder auf das hinweisen, was ich abgehakt habe. Ehemalige Freunde, die sich in die Gegenwart drängen. Briefe, Fotos, Eintrittskarten, die in Ritzen und dunklen Ecken auftauchen. Und ich. Wie ich war und wie ich bin; wie ich mich entwickelt habe und was alles noch in mir steckt. Und sich nicht einfach streichen lässt.
So erwidere ich den Gruß des Monsters, verringere meine Geschwindigkeit und lasse es neben mir laufen. Ich blicke es an und sehe mich. Lächle mich an und nicke meiner Vergangenheit zu, die mich auf meinem Weg in die Zukunft begleitet.
Was geschehen ist, hilft mir, mich zu entscheiden.
Was getan wurde, gibt mir Erfahrung und Mut.
Was gelebt wurde, bin ich.
Donnerstag, 7. Februar 2013
Die Uhr.
Ich sitze im Wartezimmer und schaue auf die Uhr. Betrachte, wie die Zeit vergeht. Wie die Zeiger unentwegt weiter ticken.
Und denke daran, wie ich hier sitze. Mich nicht vom Fleck rühre. Und so viel anderes tun könnte.
Wie ich nur warte. Auf die Ärztin, die es nie schafft, ihre Termine einzuhalten. Auf ihre Gutachten. Ihre Meinung über mich. Ihre Entscheidung für mich. Auf mein Leben.
Und immer noch sitze ich hier. Die Uhr fest im Blick. Die Unsinnigkeit fest im Blick. Unsinnig, wie die Zeit immer weiter geht. Egal ob ich laufe oder stehenbleibe. Ob ich mich freue oder einsam bin. Ob ich lebe oder sterbe. Unsinnig, wie ich hier sitze. Anstatt zu leben.
Egal ob meine Ärztin noch kommt oder nicht. Was sie mir sagen wird. Und was nicht. Ich warte immer noch. Und ich habe noch Zeit. Zeit zu gehen und ihr nicht zuzuhören. Zeit mich aus dem Staub zu machen und spurlos zu verschwinden. Zeit zu leben.
Aber ich nutze sie nicht. Ich bleibe sitzen. Schaue weiter auf die Uhr. Warte weiter auf Wunder. Lebe weiter. Wartend.
"So, kommen Sie bitte!"
Beim Aufstehen werfe ich einen letzten Blick auf das Ziffernblatt. Und merke, dass die Uhr schon die ganze Zeit stehengeblieben war.
Und denke daran, wie ich hier sitze. Mich nicht vom Fleck rühre. Und so viel anderes tun könnte.
Wie ich nur warte. Auf die Ärztin, die es nie schafft, ihre Termine einzuhalten. Auf ihre Gutachten. Ihre Meinung über mich. Ihre Entscheidung für mich. Auf mein Leben.
Und immer noch sitze ich hier. Die Uhr fest im Blick. Die Unsinnigkeit fest im Blick. Unsinnig, wie die Zeit immer weiter geht. Egal ob ich laufe oder stehenbleibe. Ob ich mich freue oder einsam bin. Ob ich lebe oder sterbe. Unsinnig, wie ich hier sitze. Anstatt zu leben.
Egal ob meine Ärztin noch kommt oder nicht. Was sie mir sagen wird. Und was nicht. Ich warte immer noch. Und ich habe noch Zeit. Zeit zu gehen und ihr nicht zuzuhören. Zeit mich aus dem Staub zu machen und spurlos zu verschwinden. Zeit zu leben.
Aber ich nutze sie nicht. Ich bleibe sitzen. Schaue weiter auf die Uhr. Warte weiter auf Wunder. Lebe weiter. Wartend.
"So, kommen Sie bitte!"
Beim Aufstehen werfe ich einen letzten Blick auf das Ziffernblatt. Und merke, dass die Uhr schon die ganze Zeit stehengeblieben war.
Mittwoch, 30. Januar 2013
Hörst du.
Ich sitze im Klassenzimmer und höre. Kann meine Ohren am Hören nicht hindern. Kann die Flut an Informationen nicht aufhalten, die in mich dringt. Kann nicht mehr differenzieren, nehme jedes Geräusch wahr.
Meine Sitznachbarin erzählt über Goethes Menschenbild. Analysiert das Gedicht. Räuspert sich.
In der vorderen Reihe blättert jemand um - vielleicht um nachzuprüfen, was gesagt wurde.
Links neben mir knackt eine Freundin mit den Fingern. Ich zucke zusammen, höre das Rascheln meiner Jacke.
Von draußen dringt Musik ins Klassenzimmer. Etwas aus den Charts, die Bauarbeiter hören offensichtlich Radio.
Und arbeiten dabei. Es kracht, es hämmert - Metall auf Metall, etwas Hartes auf Holz.
Die Plane vorm Fenster weht im Wind, das Knistern übertönt meine Lehrerin. In meinen Gedanken.
Jemand rückt seinen Stuhl zurecht.
Von irgendwo kommt das Klicken eines Kugelschreibers. Ob wohl jemand nervös ist?
Und schon spricht eine andere Schülerin. Auch über Menschenbilder. Nur das Geräusch kommt zu mir durch. Ich bin nicht in der Lage, den Inhalt aufzunehmen. Ich höre die Stimme. Als Hintergrund zu den Schritten der Personen, die an der geschlossenen Tür vorbeilaufen.
Jedes Geräusch zieht meine Wahrnehmung aufs Neue an sich. Kaum eine Abfolge an Tönen kann ich zu Ende verfolgen.
Immer dringt etwas Neues auf mich ein. Drängt sich auf. Drängt sich durch meinen Gehörgang in mich.
Es scheint still zu sein in der Klasse - die Frage der Deutsch-Lehrerin kann offensichtlich keiner beantworten.
Und ich halte mir die Ohren zu.
Es ist so laut.
Meine Sitznachbarin erzählt über Goethes Menschenbild. Analysiert das Gedicht. Räuspert sich.
In der vorderen Reihe blättert jemand um - vielleicht um nachzuprüfen, was gesagt wurde.
Links neben mir knackt eine Freundin mit den Fingern. Ich zucke zusammen, höre das Rascheln meiner Jacke.
Von draußen dringt Musik ins Klassenzimmer. Etwas aus den Charts, die Bauarbeiter hören offensichtlich Radio.
Und arbeiten dabei. Es kracht, es hämmert - Metall auf Metall, etwas Hartes auf Holz.
Die Plane vorm Fenster weht im Wind, das Knistern übertönt meine Lehrerin. In meinen Gedanken.
Jemand rückt seinen Stuhl zurecht.
Von irgendwo kommt das Klicken eines Kugelschreibers. Ob wohl jemand nervös ist?
Und schon spricht eine andere Schülerin. Auch über Menschenbilder. Nur das Geräusch kommt zu mir durch. Ich bin nicht in der Lage, den Inhalt aufzunehmen. Ich höre die Stimme. Als Hintergrund zu den Schritten der Personen, die an der geschlossenen Tür vorbeilaufen.
Jedes Geräusch zieht meine Wahrnehmung aufs Neue an sich. Kaum eine Abfolge an Tönen kann ich zu Ende verfolgen.
Immer dringt etwas Neues auf mich ein. Drängt sich auf. Drängt sich durch meinen Gehörgang in mich.
Es scheint still zu sein in der Klasse - die Frage der Deutsch-Lehrerin kann offensichtlich keiner beantworten.
Und ich halte mir die Ohren zu.
Es ist so laut.
Samstag, 26. Januar 2013
Zwölf Kisten Leben.
Zwölf Kisten, gestapelt in meinem Zimmer. Gefüllt mit meinem Leben. Beschriftet mit Oberbegriffen.
Mein Leben, sortiert. Mein Leben, zusammengeräumt.
Die Regale leergeräumt, Schränke voller Luft.
Mein Leben, rausgescheucht. Nichts zurückgeblieben.
Wie belanglos. 12 Kisten für 18 Jahre. Alles, was mich ausmacht, in Pappe verpackt.
Ein wenig Regen würde mein Leben vernichten.
Alles auslöschen, wegschwemmen, zunichte machen.
Und plötzlich wünsche ich mir Regen. Würde die Kisten am liebsten aus dem Fenster werfen.
Würde gerne allein dastehen. Ohne Besitz. Ohne Vergangenheit.
Nur mit mir. Mit neuen Chancen und neuem Leben. Neuen Möglichkeiten und neuen Ideen.
Ich lasse alle Kartons hier stehen. Werde alle in den Transporter laden und mitnehmen.
In mein neues Leben. Mit neuen Chancen und neuen Ideen.
Weil die zwölf Kisten zwar mein Leben sind. Aber ich selbst meine Zukunft bin.
Mein Leben, sortiert. Mein Leben, zusammengeräumt.
Die Regale leergeräumt, Schränke voller Luft.
Mein Leben, rausgescheucht. Nichts zurückgeblieben.
Wie belanglos. 12 Kisten für 18 Jahre. Alles, was mich ausmacht, in Pappe verpackt.
Ein wenig Regen würde mein Leben vernichten.
Alles auslöschen, wegschwemmen, zunichte machen.
Und plötzlich wünsche ich mir Regen. Würde die Kisten am liebsten aus dem Fenster werfen.
Würde gerne allein dastehen. Ohne Besitz. Ohne Vergangenheit.
Nur mit mir. Mit neuen Chancen und neuem Leben. Neuen Möglichkeiten und neuen Ideen.
Ich lasse alle Kartons hier stehen. Werde alle in den Transporter laden und mitnehmen.
In mein neues Leben. Mit neuen Chancen und neuen Ideen.
Weil die zwölf Kisten zwar mein Leben sind. Aber ich selbst meine Zukunft bin.
Donnerstag, 24. Januar 2013
Elf.
„An diese Annie solltest du dich halten, Darling“, riet sie
mir. „Geh sie besuchen. Von verrückten Leuten kann man eine Menge lernen.“
[Die Mitte der Welt - Andreas Steinhöfel]
Ich wurde getaggt. Dreimal mittlerweile. Deswegen mache ich das jetzt mal gerne :)
Von Dreamcatcher:
1. Was ist dein Lieblingsbuch?
Fällt mir schwer, mich da auf eins festzulegen. Aber wenn ich mich festlegen muss, wohl 'Extrem laut und unglaublich nah' von Jonathan Safran Foer.
2. Ein inspirierender Spruch?
"Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do." - Mark Twain
3. Was würdest du tun, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest?
Den ganzen Tag durch die Stadt laufen, Bahn fahren, fremde Leute anlächeln und ansprechen.
4. Welchen Blog findest du am besten?
Den von Jades
5. Welche Lüge benutzt du am häufigsten?
"War heute was Besonderes los?" - "Nein."
6. Magst du dich?
Ja.
7. Worauf bist du stolz?
Entwicklung in vierlerlei Hinsicht
8. Vermisst du jemanden?
Ja.
9. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr?
Nein, hatte ich nicht. Die würde ich eh nicht umsetzen.
10. Wo bist du am liebsten?
Bei meiner Tante und meinem Onkel
11. Bist du lieber allein oder unter Menschen?
Meistens lieber allein, unter gewissen Menschen gerne und von Zeit zu Zeit auch gerne unter vielen.
Und von Jades:
1. Welche sind deine drei Lieblingswörter?
einfach, Giraffe, wundervoll
2. Wie definierst du Liebe?
Sich toll finden, auch wenn man sich nicht sieht; glücklich sein, auch wenn man miteinander schweigt; plötzlich lachen können, auch wenn man schlecht drauf ist; eine Person toll zu finden, auch wenn man sie kennt.
3. Was kommt, deiner Meinung nach, nach dem Tod?
Bestenfalls das unvorstellbare Nichts
4. Glaubst du, das Leben wäre einfacher, wenn man seinen Sinn kennen würde?
Ich denke, der Sinn des Lebens ist individuell und variabel, daher schwer zu kennen. Und außerdem: Nein, glaube ich nicht.
5. Welches ist dein Lieblingszitat? Warum?
"What day is it,?" asked Pooh.
"It's today," squeaked Piglet.
"My favorite day," said Pooh.
Weil es so selbstverständlich klingt, so kindlich, so optimistisch. Und trotzdem so wahr, so wichtig und so groß ist.
6. Glaubst du an Schicksal?
Ja, in manchen Situationen glaube ich an etwas, das man als Schicksal bezeichnen könnte.
7. Dein größter Wunsch für die Zukunft?
aufzuwachen und zu merken, dass ich erreicht habe, wofür ich gekämpft habe; und glücklich darüber zu sein
8. Was assoziierst du mit den Worten Stille, Kuss und Ende?
Einsamkeit, Liebe, Neuanfang
9. Was liebst du wirklich?
Freiheit
10. Für was würdest du sterben, ohne zu überlegen?
Für nichts, außer für die Zeit
11. Was rettet dich vor dir selbst?
Ich selbst
Und von Misa Shibuya:
1. Gibt es ein Lied, das dein Leben sehr beeinflusst (hat) oder einfach so sehr wichtig für dich ist? Wenn ja, welches?
Ja, Simple Man von Shinedown.
2. Gibt es etwas in deinem Leben, das du bereust? Was ist es?
Ja, gibt es - aber hauptsächlich Kleinigkeiten. Wenn ich jetzt etwas Bestimmtes benennen soll, dass ich mal zurück nach Hause gezogen bin.
3. Würdest du dem Spruch "In 20 years, you will be more disappointed by what you didn't do than what you did" zustimmen?
Ja.
4. Vermisst du gerade eine Person/ein Gefühl?
Ja, eine Person hauptsächlich.
5. Hast du irgendwelche außergewöhnlichen Hobbies, Fähigkeiten oder Interessen?
Oh ja, wer hat das nicht! Ich mag Statistiken und Listen, ich klettere, ich mag Gedankenspiele. Außergewöhnlichkeit ist relativ.
6. Machst du dir viele Gedanken über die Gesellschaft und die Zukunft der Menschen, wenn es so weitergeht wie bisher? Wenn ja: Was stört dich am meisten, welches Problem sollte deiner Meinung nach als erstes gelöst werden?
Ich mache mir Gedanken, weil ich mir über vieles Gedanken mache. Aber die Gedanken müssen ja nicht unbedingt negativ sein. Unabhängig von der vorherigen Frage: Am meisten stört mich die Unwissenheit und Ignoranz vieler; was als erstes gelöst werden sollte, kann ich nicht wirklich sagen, da vieles wohl auch zusammenhängt.
7. Was macht dich glücklich?
Kinder, die lächeln; Zusammenhalt; Zufriedenheit; Wärme; Erfolge; Küsse; Heimatgefühle; Wissen; Sport; gute Bücher; Musik; Stolz; helfen und unterstützen; lachen; etwas geschafft zu haben; Entdeckungen; Ruhe; Schönheit und das Leben.
8. Hast du ein Vorbild oder eine Person, die dich sehr inspiriert? Welche? Und warum gerade die?
Eine Person, die mich inspiriert, ist Skylar. Weil er das Leben mit ganz besonderen Augen sieht und seinen Blick mit anderen teilt.
9. Was sind deine größten Stärken und Schwächen? Hast du das Gefühl, dass du dich sehr von deinen Schwächen beeinflussen lässt?
Die Fähigkeit, über mich selbst und andere nachzudenken, Verhalten zu hinterfragen, Dinge schnell zu verstehen, gut auf andere eingehen zu können. Introvertiertheit, die oft zu Schüchternheit neigt und oft wie Desinteresse wirkt, Sarkasmus an den falschen Stellen, Faulheit, immer wieder ein Nicht-Stehen zu meinen Fehlern. Mein Charakter besteht auch aus meinen Schwächen, daher beeinflussen auch die mich und mein Verhalten, sicher. Das tun meine Stärken aber auch.
10. Was ist dein schönstes/wichtigstes Erlebnis im letzten Jahr gewesen?
Das Kennenlernen einer wundervollen Person.
11. Welcher Satz, der jemals zu dir gesagt wurde, ist am besten in deinem Gedächtnis geblieben?
"Du bist inspirierend."
Und von Misa Shibuya:
1. Gibt es ein Lied, das dein Leben sehr beeinflusst (hat) oder einfach so sehr wichtig für dich ist? Wenn ja, welches?
Ja, Simple Man von Shinedown.
2. Gibt es etwas in deinem Leben, das du bereust? Was ist es?
Ja, gibt es - aber hauptsächlich Kleinigkeiten. Wenn ich jetzt etwas Bestimmtes benennen soll, dass ich mal zurück nach Hause gezogen bin.
3. Würdest du dem Spruch "In 20 years, you will be more disappointed by what you didn't do than what you did" zustimmen?
Ja.
4. Vermisst du gerade eine Person/ein Gefühl?
Ja, eine Person hauptsächlich.
5. Hast du irgendwelche außergewöhnlichen Hobbies, Fähigkeiten oder Interessen?
Oh ja, wer hat das nicht! Ich mag Statistiken und Listen, ich klettere, ich mag Gedankenspiele. Außergewöhnlichkeit ist relativ.
6. Machst du dir viele Gedanken über die Gesellschaft und die Zukunft der Menschen, wenn es so weitergeht wie bisher? Wenn ja: Was stört dich am meisten, welches Problem sollte deiner Meinung nach als erstes gelöst werden?
Ich mache mir Gedanken, weil ich mir über vieles Gedanken mache. Aber die Gedanken müssen ja nicht unbedingt negativ sein. Unabhängig von der vorherigen Frage: Am meisten stört mich die Unwissenheit und Ignoranz vieler; was als erstes gelöst werden sollte, kann ich nicht wirklich sagen, da vieles wohl auch zusammenhängt.
7. Was macht dich glücklich?
Kinder, die lächeln; Zusammenhalt; Zufriedenheit; Wärme; Erfolge; Küsse; Heimatgefühle; Wissen; Sport; gute Bücher; Musik; Stolz; helfen und unterstützen; lachen; etwas geschafft zu haben; Entdeckungen; Ruhe; Schönheit und das Leben.
8. Hast du ein Vorbild oder eine Person, die dich sehr inspiriert? Welche? Und warum gerade die?
Eine Person, die mich inspiriert, ist Skylar. Weil er das Leben mit ganz besonderen Augen sieht und seinen Blick mit anderen teilt.
9. Was sind deine größten Stärken und Schwächen? Hast du das Gefühl, dass du dich sehr von deinen Schwächen beeinflussen lässt?
Die Fähigkeit, über mich selbst und andere nachzudenken, Verhalten zu hinterfragen, Dinge schnell zu verstehen, gut auf andere eingehen zu können. Introvertiertheit, die oft zu Schüchternheit neigt und oft wie Desinteresse wirkt, Sarkasmus an den falschen Stellen, Faulheit, immer wieder ein Nicht-Stehen zu meinen Fehlern. Mein Charakter besteht auch aus meinen Schwächen, daher beeinflussen auch die mich und mein Verhalten, sicher. Das tun meine Stärken aber auch.
10. Was ist dein schönstes/wichtigstes Erlebnis im letzten Jahr gewesen?
Das Kennenlernen einer wundervollen Person.
11. Welcher Satz, der jemals zu dir gesagt wurde, ist am besten in deinem Gedächtnis geblieben?
"Du bist inspirierend."
Und meine 11 Fragen:
1. Wenn du jetzt die Augen schließt und ganz ruhig bist, was hörst du?
2. Welches Buch steht in der zweiten Reihe an siebter Stelle von links in deinem Bücherregal?
3. Auf welchen Sprachen kannst du bis zehn zählen?
4. "Oh, die Person ist so unbeschreiblich!" An wen denkst du? Beschreibe ihren / seinen Charakter, vor allem, was daran "unbeschreiblich" ist.
5. Was ist dein Lieblings-Smiley?
6. Was kannst du gar nicht ab?
7. Welches Tier beschreibt dich / deinen Charakter / dein Verhalten am besten?
8. Welches Gedicht gefällt dir besonders?
9. Wenn du nur eine Frage stellen dürftest, um einen Menschen kennenzulernen, welche wäre das?
10. Was hast du im letzten Traum, an den du dich erinnern kannst, geträumt?
11. Welches Ereignis hat dein Leben rückblickend betrachtet am meisten beeinflusst?
Und 11 Dinge über mich:
1. Ich bin morgens schlecht gelaunt.
2. Ich habe 6 Kissen in meinem Bett.
3. Ich bin gut in Mathe.
4. Ich habe generell zwei verschiedenfarbige Socken an.
5. Wenn mir jemand eine Aufgabe stellt, will ich sie lösen; wenn ich etwas nicht weiß, will ich es herausfinden.
6. Ich suche einen Kletterpartner.
7. Wenn ich keinen dringenden Termin habe, fahre ich mit Bus und Bahn oft weiter als ich eigentlich müsste oder habe kein konkretes Ziel.
8. Ich gucke mir gerne mein Bücherregal an.
9. Ich verliere sehr ungern und gebe sehr ungern Schwäche zu.
10. Dienstag ist für mich der schlimmste Tag der Woche.
11. Recht große Differenzen zwischen meinen Erwartungen und meiner Motivation führen immer wieder zu Enttäuschungen.
Und ich tagge:
Alle, die meinen Blog lesen.
Der Einfachheit halber.
Und weil ich jedem Menschen gerne Fragen stelle, der sich Zeit nehmen und Gedanken machen möchte.
Übrigens sowohl diejenigen, die mir folgen, als auch die, die es nicht tun.
Und auch die, die nur beantworten möchten, ohne Fragen zu stellen, Leute zu taggen oder Fakten zu erzählen.
Abonnieren
Posts (Atom)